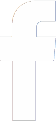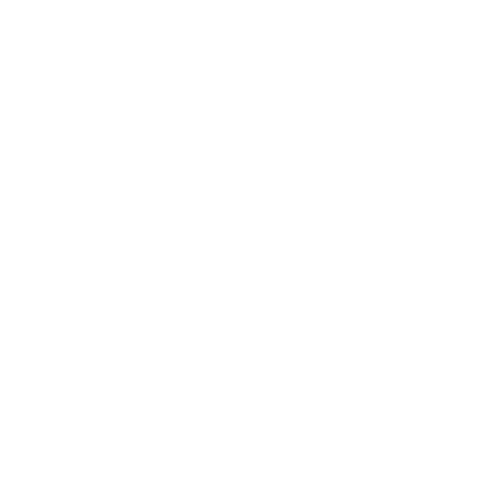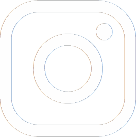23. April 2025
23. April: Tag des Buches
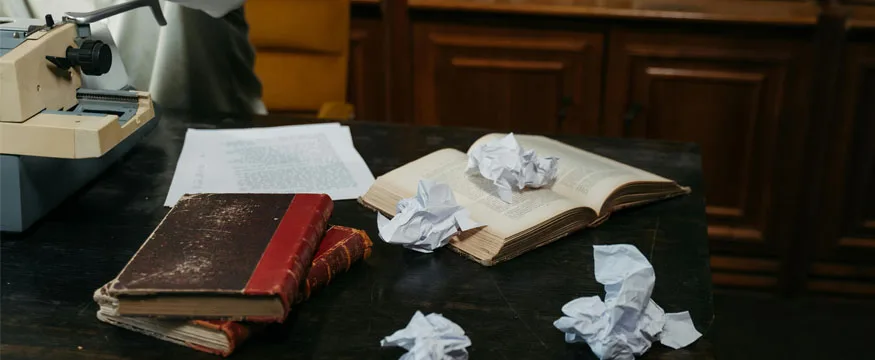
Im Jahr 1995 rief die UNESCO, die UN-Organisation für Kultur und Bildung, den »Welttag des Buches« ins Leben. Seitdem wird dieser jährlich weltweit mit den verschiedensten Aktionen begangen. Ursprung dieses Welttages ist die katalanische Tradition, Rosen und Bücher zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg (Diada de Sant Jordi) zu verschenken. Interessant ist außerdem, dass der 23. April der Todestag der bedeutenden Schriftsteller William Shakespeare und Miguel de Cervantes ist.
In Deutschland verschenken Buchhandlungen jedes Jahr ein »Welttagsbuch« der Reihe »Ich schenk dir eine Geschichte« an über 1 Million Schülerinnen und Schüler, um diesen die Freude am Lesen zu vermitteln. Auch die Deutsche Post verschenkt an diesem Tag an 1.000 Personen Buchpakete. Eine weitere Aktion ist die »Lese-Reise«: Rund um den 23. April finden in ganz Deutschland eine Vielzahl an Lesungen von Autorinnen und Autoren der avj-Verlage für Kinder und Jugendliche statt. All diese Aktionen sollen die Freude am Lesen fördern, aber auch auf die Rechte von Autorinnen und Autoren lenken – Stichwort Urheberrecht bzw. Urheberschaft.
In sprachlicher Hinsicht fällt uns hier auf: Für Personen, die – im engeren oder im weiteren Sinne – als Autorin oder Autor tätig sind, gibt es viele verschiedene Bezeichnungen. In diesem Sinne nehmen wir den Welttag des Buches zum Anlass, uns einige von ihnen einmal genauer anzuschauen. Wo liegt ihr Ursprung und was bedeuten sie? Während viele dieser Personenbezeichnungen – wenn sie denn noch gebräuchlich sind – getrost als Synonyme verwendet werden können, sollten einige lieber vorsichtig genutzt werden.
Autor, Autorin:
Das Wort Autor[1] wurde im 15. Jahrhundert aus dem lateinischen auctor, autor mit der Bedeutung ›Förderer, Veranlasser, Urheber‹ entlehnt. Die Übernahme des Ausdrucks beeinflusste übrigens das deutsche Wort urhap und sorgte so für die Entstehung des Wortes urheber. Autor wird zumeist als Bezeichnung für den Verfasser eines Werkes der Literatur, noch allgemeiner auch eines Textes jeder Art verwendet; seit Ende des 19. Jahrhunderts wird Autor aber auch als Bezeichnung für Schöpferinnen und Schöpfer anderer künstlerischer Werke gebraucht. Die ursprüngliche Bedeutung ›Urheber‹ bleibt im Deutschen relevant und tritt in Neologismen wie Bildautor und Musikautor deutlich hervor. Somit sind die beiden Ausdrücke Autor und > Urheber eng miteinander verknüpft. Das Wort Autor kam schon vor den Ausdrücken > Schriftsteller und > Verfasser auf, wurde später aber zunehmend zum Konkurrenzwort.
Dichter, Dichterin:
Unter dem Dichter versteht man heute den Verfasser lyrischer Werke. Der Bedeutungsunterschied zum > Lyriker besteht darin, dass sich der Dichter durch starke Empfindungsfähigkeit, Erlebnisfähigkeit und Ausdrucksfähigkeit auszeichnet. So schafft der Dichter nicht nur Lyrik, sondern vielmehr sprachliche Kunstwerke. Das Wort dichten leitet sich von dem althochdeutschen Wort tihtōn ›sprachlich gestalten, abfassen‹ und dem mittelhochdeutschen tihtære ab. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde das Wort Dichter auch auf Verfasser nicht lyrischer Schriften angewandt; so gab es beispielsweise die Ausdrücke Briefdichter, Pasquillendichter (eine Pasquille ist eine anonyme Spottschrift) und Schriftdichter, gemeint waren jeweils die Verfasser von Bitt- und Rechtsschriften. Bereits im 17. Jahrhundert verwendete Friedrich von Logau das Wort Dichter als Gegensatz zu > Poet: »Doch pflegen insgemein, / Wo viel Poeten sind, viel Dichter auch zu seyn.« Ab dem 18. Jahrhundert wurde der Ausdruck Dichter bevorzugt verwendet, um die sprachlich-künstlerische Gestaltung der Werke zu betonen und diese von den einfachen lyrischen Werken der Poeten abzugrenzen.
Dramatiker, Dramatikerin:
Als Dramatiker wird der Verfasser von Texten der Gattung Drama bezeichnet. Das Wort stammt ursprünglich aus dem Griechischen, ins Deutsche kam es jedoch vermutlich über lateinisch dramaticus. Der Ausdruck Drama, griechisch drãma, spätlateinisch drama, trug ursprünglich die Bedeutung ›Handlung, Geschehen‹. Obwohl Drama schon im 16. Jahrhundert entlehnt wurde, wurde das Wort erst ab dem 18. Jahrhundert geläufig. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde es auch nach dem deutschen Sprachsystem flektiert (Plural: Dramen, zuvor: Dramata). Zum einen stellt Drama einen Gattungsbegriff für alle Theaterstücke dar, sowohl Tragödien als auch Komödien. Zum anderen kann Drama aber auch spezifisch für ein ernstes Schauspiel mit gegebenenfalls tragischem Ende genutzt werden.
Epiker, Epikerin:
Hierbei handelt es sich um eine Entlehnung aus dem lateinischen epicus und dem griechischen epikós. Seit dem 19. Jahrhundert wird die Bezeichnung Epiker auch in Deutschland verwendet. Der Epiker verfasst Texte der literarischen Gattung Epik; diese umfasst jede Art von Erzählung in Vers- oder Prosaform. Versform meint die »gebundene Rede«, also ein literarisches Werk, welches in Versen verfasst wurde. Prosaform hingegen bezieht sich auf die »ungebundene Rede«, sie ist weder durch Reim, Rhythmus noch Verse gebunden. Im 19. Jahrhundert trug Epik lediglich die Bedeutung ›erzählende Dichtkunst‹.
Erzähler, Erzählerin:
Der Ausdruck Erzähler hat mehrere Bedeutungen. So beschreibt man eine Person, die etwas mündlich erzählt, als Erzähler, aber auch der Verfasser literarischer Werke wird als Erzähler betitelt. In der Literaturwissenschaft versteht man unter dem Erzähler eine fiktive Gestalt, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird. Das Wort leitet sich von dem Verb erzählen ab; dieses hat seinen Ursprung in dem althochdeutschen irzellen bzw. dem mittelhochdeutschen erzel(le)n mit der Bedeutung ›mündlich mitteilen, berichten‹.
Konzipient, Konzipientin:
Das Wort Konzipient leitet sich von dem lateinischen Wort concipiens (deutsch ›konzipieren‹) ab. Konzipient beschreibt den Verfasser eines schriftlichen Werkes und wurde in dieser Bedeutung im 18. und 19. Jahrhundert genutzt. So gibt es mehrere Belege, dass Goethe dieses Wort in der Schreibweise Concipient nutzte. Mittlerweile ist der Ausdruck jedoch veraltet und wird kaum noch gebraucht. Im Österreichischen wird er hingegen für einen in einem Anwaltsbüro tätigen Juristen verwendet.
Literat, Literatin:
Dieses Wort wurde im 16. Jahrhundert aus dem lateinischen litterātus mit der Bedeutung ›schriftkundig, gelehrt, wissenschaftlich gebildet‹ entlehnt. Nachdem sich das Bedeutungsspektrum zunächst zu ›Sprachgelehrter, Philologe‹ verkleinerte, wird Literat heute meist als Synonym von > Schriftsteller verwendet. Jedoch enthält das Wort eine verächtliche Komponente, da es häufig im Sinne von ›unschöpferischer Vielschreiber‹ gebraucht wird (siehe auch > Vielschreiber). Dies ist eine relativ junge Entwicklung, so ist Literat in Wörterbüchern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts noch nicht als abwertender Ausdruck gekennzeichnet. Belege für diese Verwendung finden sich ab der Mitte des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel bei Kurt Tucholsky: »Nichts ist verächtlicher, als wenn Literaten Literaten Literaten nennen.«
Lyriker, Lyrikerin:
Als Lyriker bezeichnet man den Verfasser von Texten der Gattung Lyrik. Der Ausdruck geht auf das griechischen lyrikós ›zur Lyra, zum Spiel der Lyra gehörig‹ zurück. Lyra meint hier das altgriechische, besonders im Mittelalter gebräuchliche gitarrenähnliche Saiteninstrument, die sogenannte Leier. In der Antike bezieht sich Lyrik zunächst auf zum Leierspiel zu singende Dichtungen. Jedoch schwindet dieser Bezug zur Musik, und seit dem 18. Jahrhundert wird allgemeiner eine emotionale Dichtung als Lyrik bezeichnet. Dennoch bilden musikalische Elemente wie Reim, Rhythmus, Verse und Strophen weiterhin elementare Bestandteile der Lyrik. Das Wort Lyriker existiert im Deutschen erst seit dem 19. Jahrhundert. Im Gegensatz zum älteren Wort > Dichter impliziert Lyriker weniger eine künstlerisch-sprachliche Gestaltung, sondern vielmehr die Vermittlung von Stimmungen, Gefühlen und Gedanken.
Poet, Poetin:
Dieses Wort leitet sich von lateinisch poeta bzw. griechisch poiētḗs ›Dichter‹ ab. Während das Wort im 16. Jahrhundert als neutraler Ausdruck entlehnt wurde, entwickelte es bereits im 18. Jahrhundert eine abfällige Assoziation. Poet wurde häufig als Bezeichnung für Dichter mit schlechtem sprachlichen Stil verwendet, sodass sich diese Konnotation festigte. Sie existiert bis heute, Poet wird zuvorderst als veraltet angesehen und sonst zumeist scherzhaft verwendet. So gibt es auch einige Sprichwörter, die diese pejorative Auslegung verdeutlichen, zum Beispiel: »Der Poet im Dorfe sein, ist nicht gut« oder »Ein guter Poet und ein guter Kegelspieler nützen dem Staate gleichviel«. So kommt es denn auch, dass seit dem 18. Jahrhundert vorrangig das Wort > Dichter verwendet wird.
Prosaschriftsteller, Prosaschriftstellerin:
Das Kompositum Prosaschriftsteller setzt sich zusammen aus den Substantiven Prosa und Schriftsteller. Durch die Zusammensetzung mit Prosa (Prosa meint die »ungebundene Rede«, die weder durch Reim, Rhythmus noch Verse gebunden ist) wird das Bedeutungsspektrum von > Schriftsteller verkleinert. So bezeichnet der Prosaschriftsteller einen Autoren, der hauptsächlich Romane, Novellen und Erzählungen schreibt.
Prosaist, Prosaistin:
Hierbei handelt es sich um ein bildungssprachliches Synonym von dem Wort Prosaschriftsteller. Im Goethe-Wörterbuch findet sich unter Prosaist jedoch auch die Beschreibung ›für einen Autor von minderwertiger, dichterisch wertloser Literatur in ungebundener Sprachform‹. Diese Bedeutung ist heute allerdings nicht mehr oder kaum noch intendiert; so wird unter Prosaist im aktuellen Duden-Universalwörterbuch lediglich auf den Eintrag > Prosaschriftsteller verwiesen.
Schmock:
Schmock stellt eine abwertende Bezeichnung für einen Schriftsteller oder einen Journalisten dar. Sie geht auf den Mitarbeiter einer Zeitung aus Gustav Freytags Lustspiel »Die Journalisten«, uraufgeführt im Jahr 1852, zurück. Der Ausdruck Schmock stammt wohl ursprünglich aus dem Jiddischen der Prager Juden, die genaue Herkunft ist jedoch ungeklärt. Schmock beinhaltet zudem das Element der Käuflichkeit und Skrupellosigkeit.
Schreiber, Schreiberin:
Der Ausdruck Schreiber umfasst mehrere Bedeutungen. Es handelt sich um ein Wort aus dem Althochdeutschen (hier: skrībāri) und dem Mittelhochdeutschen (hier: schrībære). Zum einen beschreibt der Schreiber lediglich eine Person, die etwas schriftlich verfasst. Früher nannte man so eine Person, die beruflich Schreibarbeiten ausübt, zum Beispiel Sekretärinnen und Sekretäre. Durch die häufige Nutzung dieses Wortes sowie die Konnotation ›abschreiben‹ hat sich zunehmend eine abqualifizierende Note entwickelt. Deshalb wurden bereits ab dem 18. Jahrhundert andere Berufsbezeichnungen gewählt. Die Bezeichnung Schreiber wird noch heute oft abwertend gebraucht, dann für den ›Verfasser, Autor eines literarischen, journalistischen o. ä. Werks‹ (Beispiel aus dem Duden-Universalwörterbuch: »Welcher Schreiber hat denn dieses Stück verbrochen?«). So hat sich Schreiber dem von Anfang an negativ konnotierten Ausdruck > Schreiberling stark angenähert.
Schreiberling:
Schreiberling ist bereits im Wörterbuch der Gebrüder Grimm aus dem 19. Jahrhundert als verächtliche Bezeichnung für den Schreiber verzeichnet. Diese Konnotation ist bis heute erhalten geblieben. So wird ein Autor, der schlecht (und viel) schreibt, oft als Schreiberling betitelt. Somit ist Schreiberling ein Synonym von > Schreiber sowie von der älteren Entsprechung > Skribent, aber auch von > Literat und von > Vielschreiber.
Schriftsteller, Schriftstellerin:
Das Wort etablierte sich im 16. Jahrhundert, es geht auf den Ausdruck eine Schrift stellen zurück: Schriftsteller war zunächst die Berufsbezeichnung für diejenigen, die für andere rechtliche Schriften aufsetzten. Erst ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entwickelte sich die heute noch aktuelle Bedeutung ›Verfasser literarischer Werke‹. Schon damals wurde Schriftsteller – neben > Verfasser – zum Konkurrenzausdruck für das bereits im 15. Jahrhundert entlehnte Wort > Autor.
Skribent, Skribentin:
Der Ausdruck Skribent wurde im 16. Jahrhundert aus dem lateinischen scrībēns ›Schreiber‹ entlehnt. Ab dem 18. Jahrhundert entwickelte sich Skribent jedoch zu einer abwertenden Bezeichnung für einen Schriftsteller. Er stellt ein Synonym von dem Wort > Vielschreiber dar: ›jemand, der sehr viel, aber tendenziell qualitativ anspruchslos schreibt‹. Somit trägt der Ausdruck eine ähnliche Bedeutung wie das Wort > Schreiberling (auch: > Schreiber). So wird im Duden-Universalwörterbuch Skribent als »bildungssprachlich abwertend« gekennzeichnet und die Bedeutung des Ausdrucks wiedergegeben mit ›Vielschreiber, Schreiberling‹.
Texter, Texterin:
Im Allgemeinen ist Texter – ›jemand, der einen Texte verfasst (hat) / der berufsmäßig textet‹ – ein Synonym von > Autor, > Schreiber, > Verfasser. Es gibt jedoch auch die speziellere Bedeutung ›jemand, der kurze Texte verfasst‹. Hiermit sind besonders Texte für Werbung, Lieder, Rundfunk oder Internet gemeint. Das Wort Texter (auch das entsprechende Verb: texten) ›Texte für die Werbung oder die leichtere Unterhaltungskunst verfassen‹ ist noch relativ jung; es etablierte sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts als Ableitung von dem Substantiv Text, das seinen Ursprung wiederum in dem lateinischen textus ›Aufeinanderfolge, Zusammenhang (der Rede), fortlaufende Darstellung‹ hat.
Urheber, Urheberin:
Ursprünglich beschreibt der Ausdruck schlicht Personen, die etwas verursacht oder bewirkt haben. Das Wort stammt von dem althochdeutschen urhab ›Sauerteig, das Sicherheben, Ursache‹ ab. Daraus entwickelte sich im Mittelhochdeutschen das Wort urhap mit der Bedeutung ›Sauerteig, Anfang, Ursprung, Ursache, Anstiftung‹. Durch Anfügen der Endung -er (Affigierung) entstand im Frühneuhochdeutschen das Wort urheber, urhaber. Dieser Ausdruck wurde wohl analog zu dem im 15. Jahrhundert entlehnten lateinischen auctor, autor (> Autor) gebildet. Besonders im juristischen Sprachgebrauch beschreibt der Ausdruck Urheber den Schöpfer eines literarischen, musikalischen, künstlerischen Werkes.
Verfasser, Verfasserin:
Der Ausdruck geht auf das Verb verfassen zurück; dieses wurde im 16. Jahrhundert durch Martin Luther geprägt und erhielt so seine heutige Bedeutung ›einen Text entwerfen und niederschreiben‹. Das mittelhochdeutsche vervaʒʒen hingegen trug die Bedeutung ›in sich aufnehmen, etwas vereinbaren‹. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts wird Verfasser als eine Verkürzung des Wortes Schriftverfasser verwendet. Seitdem stellt Verfasser eine gängige Bezeichnung für den Schöpfer (literarischer) Werke dar. Der Ausdruck entstand zeitgleich mit > Schriftsteller; das Wort > Autor erhielt Konkurrenz.
Vielschreiber, Vielschreiberin:
Dieser Ausdruck ist seit dem 18. Jahrhundert im Deutschen gebräuchlich. Zunächst stellte er einen neutralen Ausdruck für Schriftsteller dar, die schlicht viele Werke schreiben oder publiziert haben. Schnell wurde Vielschreiber in einer herabmindernden Weise verwendet – denn in kürzester Zeit möglichst viele literarische Werke auf den Markt zu bringen mag auch für eine geringe Qualität der Ergebnisse stehen. Krünitz liefert in seiner Enzyklopädie die anschauliche Beschreibung: »Schriftsteller, der zu viel schreibt, besonders Romane, sich gleichsam bei einem Buchhändler verdingt, um ihm jede Messe ein Paar zu liefern, also mit seinen nur flüchtig entworfenen und bearbeiteten Manuscripten sogleich in die Druckerey eilt, um nur seine Verleger zu befriedigen, auch wohl um seine eigene kärgliche Einnahme, als Verfasser, zu mehren.« Diese Nutzung, die hier implizit auf ein schlechtes Schreibniveau verweist, ist bis heute erhalten geblieben; so ist Vielschreiber ein Synonym von dem in derselben Zeit entstandenen Ausdruck > Skribent, aber auch von den jüngeren Wörtern > Schreiber, > Schreiberling und > Literat.
Quellen
Deutsches Rechtswörterbuch, https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige.
Deutsches Sprichwörter-Lexicon von Karl Friedrich Wilhelm Wander, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/23, https://www.woerterbuchnetz.de/Wander.
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/23, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB.
Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS), https://www.dwds.de/.
Duden – Die deutsche Rechtschreibung, 29. Auflage, Berlin 2024.
Duden – Das Synonymwörterbuch, 7. Auflage, Berlin 2019.
Duden – Das Universalwörterbuch, 9. Auflage, Berlin 2019.
Goethe-Wörterbuch, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/23, https://www.woerterbuchnetz.de/GWB.
Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart (Ausgabe letzter Hand, Leipzig 1793–1801), digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/23, https://www.woerterbuchnetz.de/Adelung.
Herders Conversations-Lexikon (1. Auflage, 1854–1857), digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/23, https://www.woerterbuchnetz.de/Herder.
Hiller, Helmut, Wörterbuch des Buches, Frankfurt am Main 1980.
Meyers Großes Konversationslexikon (6. Auflage, 1905–1909), digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/23, https://www.woerterbuchnetz.de/Meyers.
Oekonomische Encyklopädie von J. G. Krünitz, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, https://www.kruenitz1.uni-trier.de/.
Projekt Gutenberg, https://www.projekt-gutenberg.org/freytag/journal/journal.html.
Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Diada_de_Sant_Jordi.
Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Journalisten.
Welttag des Buches, https://www.welttag-des-buches.de/welttag-des-buches.
Wörterbuchnetz, https://www.woerterbuchnetz.de/.
Zum Weiterlesen
Gesellschaft für deutsche Sprache, 9. August: Tag der Buchliebhaber, in: An diesem Tag …, https://gfds.de/9-august-tag-der-buchliebhaber/.
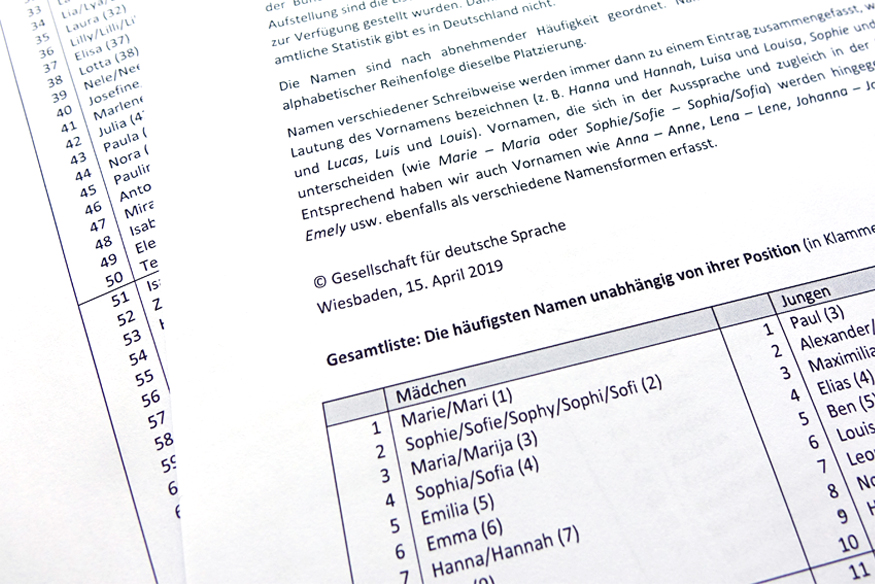
Zum Weiterlesen
In unserer Rubrik »An diesem Tag …« haben wir uns schon einmal mit dem Thema Bücher befasst, nämlich zum Tag der Buchliebhaber am 9. August. Diesen Artikel finden Sie hier:
[1] Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir in den Erläuterungen zu den Personenzeichnungen auf die jeweils weibliche Form.