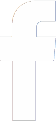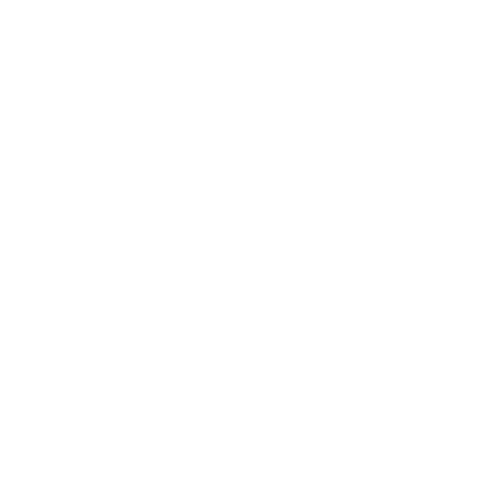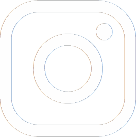Sollten Vornamen mit oder ohne Artikel verwendet werden?
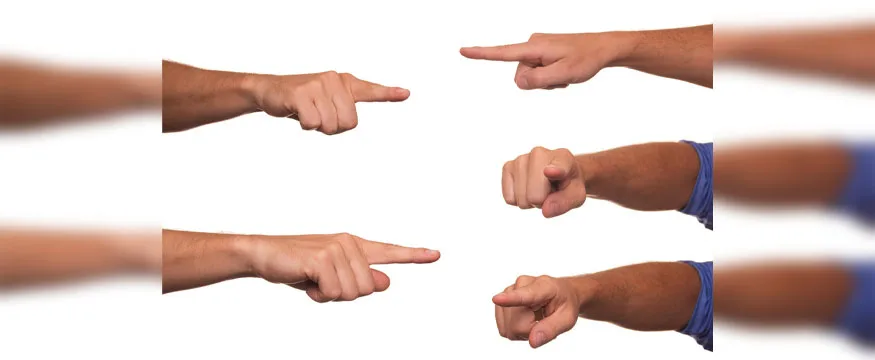
[F] Stimmt es, dass es zwar nicht falsch ist, Vornamen mit Artikel zu schreiben, aber dass das eben auch nicht schön ist und man daher den Artikel weglassen sollte? Bei einem Familientreffen gestern haben wir darüber diskutiert.
[A] Der Komplex »Eigenname und Artikel« ist in der Forschung noch nicht gänzlich geklärt. So haben Eigennamen als spezielle Substantive, die z. B. Individuen bezeichnen, eine ganz eigene Grammatik. Insbesondere das Setzen des bestimmten Artikels vor Vornamen ist kompliziert. Laut Friedhelm Debus (2012) ist gerade durch die Tatsache, dass der Vorname auf eine bestimmte Person referiert, der bestimmte Artikel hier, nicht aber bei normalen Substantiven, eigentlich überflüssig (das Paket ist eingetroffen vs. Peter ist eingetroffen).
Nach Damaris Nübling (2012) steht fest: Standardsprachlich steht der bestimmte Artikel grundsätzlich nicht. Allerdings würden ihn viele Personen in der Sprechsprache nutzen. Wie dies zu bewerten ist, hänge davon ab, »wo in Deutschland wir uns befinden«. So sei der Gebrauch des definiten Artikels vor Vornamen im gesamten Süden (einschließlich Schweiz, Österreich, Luxemburg) umgangssprachlich und in den Dialekten üblich, sogar »obligatorisch«. Lässt man ihn weg, wirke dies »hochnäsig« und »bemüht standardintendiert«. In Mitteldeutschland komme es auf den Kontext an, ob der Artikel gebraucht wird oder nicht. Und in Norddeutschland höre man die Verbindung von Artikel und Vorname gar nicht gerne.
Nübling stellt aber weiterhin heraus, dass es nicht nur in der Mitte von Deutschland auf den jeweiligen Kontext ankommt, sondern grundsätzlich, und verweist auf eine einzige Studie, die dieses Phänomen mittels Interviews untersucht hat; das war 1990. So weisen wir darauf hin, dass sich unsere Sprache seither freilich weiterentwickelt hat und die individuellen Spracherfahrungen hiervon abweichen können.
Nach der Studie gilt für den Norden, dass der Artikel mitunter gesetzt wird. Er übernimmt dann spezielle Funktionen. Insbesondere drückt er eine negative Haltung des Sprechers zum Gegenüber und allgemein (negative, aber auch positive) Expressivität aus (Der Peter hat mich geschlagen; Der Peter kommt). In solchen oder ähnlichen Sätzen wird der Artikel unter Umständen wie das Demonstrativpronomen dieser verstanden, zum Ausdruck von Bekanntheit und Distanz gleichermaßen, im Sinne von ›von dem wir mal gesprochen haben, von dem man so hört‹; in der Tat geht auch im Standarddeutschen eine (negative) wertende Wirkung von der Verbindung von Demonstrativpronomen und Vornamen aus (Dieser Peter ist mir sehr suspekt). Ferner hat man gesehen, dass der bestimmte Artikel im Norden zum Ausdruck des Dativs genutzt wird (Gib das mal dem Peter). Dagegen wird er unterdrückt, wenn die bezeichnete Person sichtbar oder anwesend ist (Das ist Peter). Der Artikel würde dann wie eine Zeigegeste verstanden werden, was als unhöflich gilt.
In der Mitte Deutschlands orientiert man sich, so die Studienergebnisse, eher am Süden. Der Artikel wird hier allerdings fast nie gesetzt, wenn man sich selbst bezeichnet und einen anwesenden Namensträger vorstellt.
Im Süden ist laut der Studie das Setzen des Definitartikels vor Vornamen Brauch. Der Artikel erfüllt hier keine Funktionen oder Konnotationen. Es wird angenommen, dass er hier grundsätzlich zur Kasuskennzeichnung verwendet wird, wie wir es in der Standardsprache im Falle des Genitivs sehen (die Leiden der Maria). Auch wird vermutet, dass die Markierung des Genus bzw. Sexus eine Rolle spielt.
Insgesamt handelt sich, so Nübling, beim Setzen des definiten Artikels vor Vornamen um ein »Phänomen der gesprochenen Umgangssprache, das sich nach Norden ausdehnt«. So können wir dem gegenüber formulieren: Im Schriftsprachlichen gilt im Allgemeinen, genauer für bestimmte Textsorten, ein distanzsprachlicher Ton. Das betrifft beispielsweise wissenschaftliche Texte, aber auch Zeitungsartikel, wenn eine überregionale Leserschaft die Zielgruppe ist. Hier lässt man den Artikel grundsätzlich, auch im Süden, weg.
Aktualisiert April 2025
Quellen
Debus, Friedhelm: Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung. Berlin 2012.
Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 9. Aufl. Berlin 2019.
Nübling, Damaris; Fahlbusch, Fabian; Heuser, Rita: Namen. Eine Einführung in die Onomastik. Tübingen 2012.