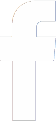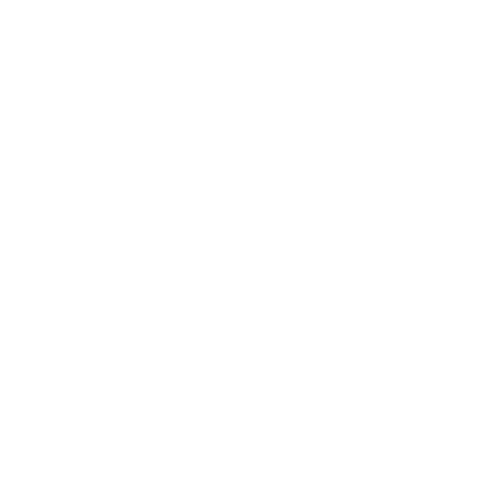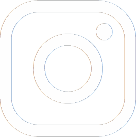14. Juni 2024
Anpfiff zur EM 2024: Was ein Ball, eine Pille und eine Kirsche gemeinsam haben

Anpfiff! Es ist so weit: Am heutigen Freitag, 14. Juni 2024, beginnt mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland die Fußball-Europameisterschaft 2024. In den kommenden vier Wochen werden Fans des runden Leders in den Stadien ihrer Nationalmannschaft zujubeln oder vor dem Fernseher verfolgen, wie die deutsche Mannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann den Ball in Richtung gegnerisches Tor kickt. Im Fußballfieber ist auch die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS): Wir werden während der Europameisterschaft Wissenswertes und Unterhaltsames zum sprachlichen Aspekt des Fußballs auf unserer Website veröffentlichen und möchten damit das sportlich-gesellschaftliche Erlebnis der EM noch etwas abrunden.
Weil beim Fußball das runde Leder im Mittelpunkt steht, fangen wir genau damit an: Welche Bezeichnungen gibt es eigentlich noch für das Spielgerät? Weiter geht es in den kommenden Tagen und Wochen mit Folgen rund um Sprachbilder im Fußball, wir werden die Bedeutung von typischen Vereinsnamen erklären sowie Spitznamen von Spielern und Trainern untersuchen. Außerdem wollen wir uns anschauen, inwiefern die Fußballsprache in der Politik eine Rolle spielt. Abschließend zeigen wir, dass die La-Ola-Welle nicht nur Spieler anfeuern soll, sondern auch ein rhetorisches Stilmittel ist, und dass Fangesänge mehr sind als nur Gegröle.
Das Runde muss ins Eckige: Welche Bezeichnungen gibt es noch für den Fußball?
»Das Runde muss ins Eckige«: So einfach ist Fußball, bringt dieser Satz, der Trainerlegende Sepp Herberger zugeschrieben wird, doch das Wesentliche auf den Punkt. Tore sollen fallen! Damit das passiert, sollte die Kugel (Umgangssprache) möglichst zwischen den deutschen Nationalspielern rollen, denn das Leder (Umgangssprache) muss über die Linie, aber bitte nicht über die vor Torhüter Manuel Neuer. Vielleicht spielt Niclas Füllkrug ja die Pille (Dialekt) direkt ins gegnerische Tor, wer weiß.
»Gib mich die Kirsche«, soll angeblich Lothar Emmerich 1966 bei Borussia Dortmund gesagt haben, als er den Ball zugespielt haben wollte. Die umgangssprachliche Redewendung ist zwar nicht zweifelsfrei ihm zuzuschreiben, wurde aber dennoch Teil des Titels eines dokumentarischen Fußballfilms aus dem Jahr 2004. In der Schweiz heißt der Fußball Bölle, und aus Österreich ist uns Wuchtel und Fetzenlaberl genannt worden.
Bolzen, Kicken und Tschutten: Wie Jugendliche das Fußballspielen nennen
Vor den Fernsehgeräten sitzen am heutigen Freitag, 14. Juni 2024, beim Eröffnungsspiel nicht nur Erwachsene und fiebern mit, sondern auch Kinder, die ganz eigene und zudem regional unterschiedlich stark verwendete Begriffe für das neutrale Wort Fußballspielen benutzen: Ohne Rücksicht auf offizielle Regeln bolzen Jungen und Mädchen in ganz Deutschland, doch ist der Begriff norddeutsch geprägt. In der Sportberichterstattung taucht Bolzen auch auf, meistens in eher abwertender Bedeutung. Gemeint ist damit laut Jürgen Eichhoff (1993: 26) »das unelegante Treten des Balles ohne rechte Überlegung«. So kann ein ganzes Spiel zum Gebolze werden, was für die Nationalelf sicherlich kein Kompliment wäre. In einigen Gegenden in Deutschland haben Stadtverwaltungen Bolzplätze eingerichtet, wodurch das Wort inzwischen auch offiziellen Charakter hat.
Kicken oder Tschutten sind weitere jugendsprachliche Wörter für das Fußballspielen unter Kindern, die aber auch das Spiel von Erwachsenen bezeichnen können. Kicken ist dabei besonders im Westen Deutschlands und im Osten Österreichs verbreitet und stammt vom englischen (to) kick ›treten‹. Es ist laut dem »Atlas zur deutschen Alltagssprache« in der Steiermark, dem Burgenland und Niederösterreich sowie Baden-Württemberg die weit überwiegend genannte Form.
Tschutten (auch tschuten, tschüt(t)ele oder schutten) ist vor allem in der deutschsprachigen Schweiz verbreitet. Diese Formen gehen auf das englische (to) shoot ›schießen‹ zurück. Ballestern ist übrigens ein alter Ausdruck für bodenständiges Fußballspielen, der seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verwendet wurde und bis in die 1980er-Jahre noch bekannt war, dann aber durch das Verb kicken weitgehend verdrängt wurde.
Quellen
Eichhoff, Jürgen: Wortatlas der deutschen Umgangssprache, 3. Bd. Berlin/New York 1993.
Elspaß, Stephan/Möller, Robert: Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA). Berlin/New York 2003 ff. Vgl. auch die Kartenansicht zur Verbreitung des Wortes Fußballspielen: www.atlas-alltagssprache.de/runde-4/f01a-b/. (Stand 04.06.2024)
Schlobinski, Peter: Keeper, Elf und Gurkenpass. (K)ein Wörterbuch der Fußballsprache. Mannheim 2010.
Wikipedia: »Gib mich die Kirsche! – Die 1. deutsche Fußballrolle«. https://de.wikipedia.org/wiki/Gib_mich_die_Kirsche!_%E2%80%93_Die_1._deutsche_Fu%C3%9Fballrolle. (Stand 11.06.2024)
Alle weiteren Beiträge dieser Reihe werden in unserem Sprachraum »Sprache und Fußball« veröffentlicht.