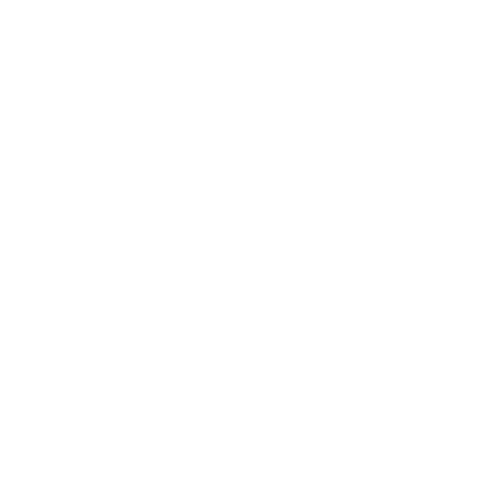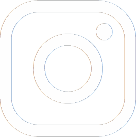Juli 2020
Coronavirus, Fachsprache und Öffentlichkeit
Interview mit Prof. Dr. Isabella Eckerle über medizinische Fachsprache und öffentliche Kommunikation

Selten standen Medizinerinnen und Mediziner derart im Zentrum wie in der Coronazeit. Informiert und diskutiert wird über vielfältige Kanäle, darunter Newsticker, Interviews, Talkshows und Podcasts. Die Wissenschaft informiert engagiert sowohl die Öffentlichkeit als auch die Politik und gibt Einblicke in ihre wissenschaftliche Praxis. Unser Mitarbeiter Dr. Torsten Siever sprach mit der Virologin Prof. Dr. Isabella Eckerle über sprachliche Herausforderungen und die Aufgaben der Wissenschaft.
Frau Prof. Dr. Eckerle, keine Wissenschaft ist für die Gesellschaft relevanter als die Humanmedizin. Daher treffen besonders hier Fachsprache und Standardsprache aufeinander, also etwa bei Influenza vs. Grippe. Zurzeit sind aber auch Ausdrücke wie Reagenzien, PCR-Testung, nosokomial und Median-Alter zu hören, wobei diese nur teilweise erklärt werden. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht im Spagat zwischen Fach- und Standardsprache?
Für uns Virologen oder Mediziner bezeichnet oft ein einziger Begriff einen ganz komplexen Sachverhalt. Die Definition, was wir damit meinen, macht es für uns untereinander sehr einfach, sehr komplexe Zusammenhänge oder sehr detaillierte Prozesse zu besprechen. Das Problem ist, dass man vergisst, dass Menschen, die nicht aus dem Bereich kommen, entweder unter dem Begriff etwas ganz anderes verstehen oder gar nicht wissen, wofür dieser steht. Das kann oft eine Quelle von Missverständnissen sein und auf Laien teilweise konfus oder widersprüchlich wirken. Viele Dinge und Begriffe, die aktuell aus der Wissenschaft oder dem Labor kommen, kannte die Öffentlichkeit bislang nicht.
Ich habe bei deutschsprachigen Interviews oft das Problem, das richtige deutsche Wort zu finden, weil es dieses Wort im Deutschen einfach nicht gibt und weil es auch kein »Laienwort« gibt.
Zudem kommen die allermeisten Fachbegriffe aus dem Englischen, wodurch ich bei deutschsprachigen Interviews oft das Problem habe, das richtige deutsche Wort zu finden, weil es dieses Wort im Deutschen einfach nicht gibt und weil es auch kein »Laienwort« gibt. Für Influenza gibt es etwa Grippe oder Virusgrippe, aber z. B. für bestimmte Proteine, Rezeptor oder für emerging viruses – so wird unser ganzes Feld bezeichnet, hier könnte man vielleicht »neu auftretende oder aufkommende Viren« sagen – ist es so, dass es keinen einfachen oder deutschen Fachbegriff gibt. Das macht es für Experten relativ schwierig, ihr Forschungsgebiet oder Forschungsergebnisse in allgemein verständlicher Sprache darzustellen; hinzu kommt, dass wir auch nie gelernt haben, wie man Fachsprache in eine Sprache »übersetzen« kann, die allgemein verständlich ist.
Könnte man daraus folgern, dass bestimmte virologische Inhalte Laiinnen und Laien gar nicht verständlich erklärt werden können?
Zumindest muss man dazu sehr ausholen, was auch sehr ermüdend ist; man kann viele Inhalte nicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Wenn ich davon ausgehe, dass der normale Zeitungsleser vielleicht Oberstufen-Biologie-Kenntnisse hat, dann muss ich erst einmal erklären, was Viren sind, warum sie eine RNA und keine DNA haben usw. – man müsste also eigentlich (lacht) erst einmal alle Grundlagen erklären, bevor man komplexere Sachverhalte erläutert. Sie kennen ja bestimmt den Podcast von Christian Drosten, der auch sehr lange erklärt, und ich kenne viele Laien, die dann sagen: »Puh, das ist mir jetzt zu kompliziert, das dauert mir zu lange.« Man muss auch willens sein, dem allem zu folgen.
Sie sprachen den Podcast Ihres Kollegen an. Gerade ältere Menschen haben aber nicht so den Zugang zu solchen Formen. Wie können Sie als Wissenschaftlerin insbesondere die Älteren erreichen, die ja besonders Corona-gefährdet sind?
Ich denke, dass die Printmedien hier eine Rolle spielen. Ich habe auch sehr gute Radio-Interviews mit Wissenschaftlern gehört. Das Thema ist zurzeit so präsent, dass auf allen Medienkanälen Informationen zu finden sind. Aber es stimmt schon: Es wäre gut, wenn es mehr vereinfachte Informationen geben würde, die vielleicht von einem Team verarbeitet werden, dem (medizinische) Experten, aber auch Kommunikationsexperten angehören, die Kenntnisse haben, wie man komplizierte Sachverhalte einfacher ausdrückt. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber im Moment wäre dies sicher etwas sehr Sinnvolles.
Bleiben wir bei der Inklusion. Hier gibt es die Leichte Sprache, die in kurzen, verständlichen Sätzen immer nur eine Aussage pro Satz erklärt – und das mit nur wenigen Fachausdrücken. Könnte man Inklusion auch im medizinischen Diskurs erreichen? Sie haben ja schon vorgeschlagen, mit Kommunikationsexperten zusammenzuarbeiten.
Ich glaube, dass dies bis zu einem gewissen Grad möglich wäre. Man kann so vielleicht keine komplexen Forschungsinhalte oder Publikationsergebnisse diskutieren, aber ich glaube, dass man die wichtigen Informationen und die Kernbotschaft – und darum geht es ja eigentlich, es geht ja nicht um den letzten Unterbefund aus irgendeiner Publikation mit einer bestimmten statistischen Methode – schon in Leichter Sprache darstellen kann.
Obwohl also die Materie äußerst komplex ist und nicht ohne Weiteres verstanden werden kann, wurde beispielsweise die sog. Heinsberg-Studie heftig diskutiert. Meinen Sie, dass Journalistinnen und Journalisten sowie Laiinnen und Laien in der Lage sind, darüber etwas auszusagen, die Studie richtig einzuschätzen?
Das Problem bei der Heinsberg-Studie war am Anfang, dass die Daten nicht zugänglich waren. Wenn man die Rohdaten oder die wissenschaftliche Publikation vorliegen hat und mit verschiedenen Kollegen oder Experten darüber spricht, findet man meistens einen Konsensus. Ich hatte das Gefühl, dass da der Diskurs gar nicht so groß ist, dass sich die Mehrheit der Virologen schon einig ist und es zwar auch polarisierende Einzelmeinungen gibt, die aber eher mit einzelnen Personen verknüpft sind. Der Diskurs, der manchmal in die Öffentlichkeit gezerrt wird, ist oft auch konstruiert.
Und das basiert ja oft auch auf einer Vereinfachung – zu sehen bei Wikipedia und Medizinportalen. Haben Sie den Eindruck, dass die medizinische Kenntnis von Laiinnen und Laien dadurch zugenommen hat? Erleichtert oder erschwert Ihnen dies die aktuelle Aufklärungsarbeit?
Ich glaube, das Problem ist nicht der Inhalt per se, sondern seriöse Inhalte von schlecht recherchierten Inhalten zu unterscheiden; bei Wikipedia gibt es, soweit ich weiß, keine Qualitätskontrolle in diesem Sinne. Bei den Medizinportalen gibt es durchaus gute, die korrigierende Ärzte, Wissenschaftler oder Naturwissenschaftler einbeziehen. Ich habe aber das Gefühl, dass es schwer ist, im Netz zu unterscheiden, welche Informationen seriös und welche schlecht recherchiert oder unseriös sind oder aus einer wie auch immer gefärbten Ecke kommen – von Impfgegnern etwa.
Noch einmal zurück zu den Fachbegriffen: Haben Sie im aktuellen Diskurs bestimmte Begriffe bewusst vermieden oder Themen ausgespart, um Verunsicherungen oder gar Panikreaktionen wie Hamsterkäufe zu vermeiden?
Bewusst ausgespart nicht, aber es gibt Wörter, bei denen ich inzwischen gelernt habe, dass wir als Wissenschaftler nicht das gleiche darunter verstehen wie Nichtfachleute. Ein gutes Beispiel ist Mutation. Für uns Virologen ist dies ein ganz neutraler, deskriptiver Begriff, der erst einmal nur dafür steht, dass im Erbgut eine Veränderung zu finden ist. Was diese Veränderung allerdings bedeutet, kann man daraus gar nicht ablesen. Wenn ich aber mit einem Journalisten oder Laien über Mutationen spreche, dann klingt da im Kopf immer sofort mit: Es wird gefährlicher, dann hat es plötzlich Superkräfte oder extrem gefährliche Eigenschaften – und diese Eigenschaften sind für uns Virologen überhaupt nicht mit Mutation verbunden.
Hat die WHO in Ihren Augen deshalb so spät von einer Pandemie gesprochen und Masken empfohlen?
Die Gründe dafür, warum man sich so schwergetan hat, den Begriff Pandemie zu verwenden, kenne ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in diese Richtung geht, weil es mit Pandemie genauso (wie mit Mutation ist) ist. Epidemie und Pandemie sind für uns erst einmal Begriffe; Pandemie bedeutet ›Ausbreitung einer Infektionskrankheit auf globaler Ebene‹. Sie sagt aber nichts darüber aus, wie schwer diese ist, wie folgenreich, ob es eine Erkrankung ist, die viele Tote fordert. Ich glaube, dass uns die Filmindustrie in Hollywood in diesem Hinblick keinen Gefallen getan hat, weil man beim Wort Pandemie sofort an Horrorfilme oder Endzeitszenarien wie »Outbreak« denkt und eben nicht an einen nüchternen Begriff, mit dem wir einfach nur die Ausbreitung einer Infektionskrankheit beschreiben. Ich glaube schon, dass es am Anfang schwierig war, diesen Begriff zu verwenden, weil man sofort diese Bilder im Kopf hat und weil er eine seriöse Diskussion über Risiken erschwert.
Dazu kommen dann noch vermeintliche Wundermittel und Verschwörungsfantasien und selbst Kolleginnen und Kollegen erheben den Vorwurf von Panikmache und Aktionismus. Wie schätzen Sie die Problematik solcher Falschmeldungen und Verzerrungen ein?
Die Problematik ist sehr, sehr groß und man hat sie am Anfang gar nicht ernst genug genommen. Ich glaube, die WHO spricht inzwischen von Infodemic.1 Die Menge an wirren Theorien und Ausgeburten an Interpretationen des Infektionsgeschehens ist schon extrem. Und ich glaube, dass gerade diese in den sozialen Medien eine extreme Eigendynamik gewinnt, die ich für sehr gefährlich halte. Wenn man z. B. in die USA schaut: Es kostet Menschenleben, wenn Leute auf eine Corona-Party gehen und danach Menschen sterben, beatmet werden müssen oder ihre ganze Familie anstecken. Man hat dies unterschätzt. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass die Eindämmung der Pandemie ganz wesentlich von diesem psychologischen, menschlichen Faktor abhängt, inwieweit wir COVID-19 tatsächlich als Bedrohung ansehen und uns nicht in irgendwelche Verleugnungstheorien flüchten. Man hat schon immer in meinem Fachgebiet gefordert, dass man die Sozialwissenschaften und auch den kulturellen Kontext stärker einbeziehen muss. Dieser Ansatz war auch schon Teil von Forschungsprojekten, aber die ganz große Relevanz erkennt man jetzt erst: Welche Dimension es haben kann und wie sehr es alle Bemühungen von wissenschaftlicher oder Public-Health-Seite zunichtemachen kann, wenn es Verschwörungstheorien gibt und die Leute sagen: »Ist mir jetzt egal, was die Wissenschaftler sagen, das stimmt sowieso alles nicht.«Und das geht ja noch weiter, wenn etwa Ihrem Kollegen Drosten Morddrohungen zuteilwerden …
Ja, das ist schrecklich!
… und Verantwortlichkeiten zugeschrieben werden – sogar bezgl. des Selbstmords des hessischen Finanzministers. Auch gegen Karikaturen hat sich Ihr Kollege vehement ausgesprochen. Teilen Sie diese Ansicht vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Medienpräsenz? Präsenz schafft immer auch Angriffsfläche.
Auch da muss ich sagen, dass die wenigsten von uns diesbezüglich Erfahrung haben und ausgebildet sind. Ich glaube, dass es extrem wichtig war, dass Personen wie Christian Drosten und auch andere Virologen in der Öffentlichkeit so präsent waren und wissenschaftliche Ergebnisse diskutierten. Dass die Diskussion derart abgedriftet ist, ist höchst unerfreulich. Ich kann nicht sagen, wie man das hätte verhindern können, aber ich finde es zutiefst erschütternd, dass die Kollegen das mitmachen mussten, gerade Christian. Ich habe selbst früher bei ihm gearbeitet, kenne ihn gut und muss sagen, dass er ein überaus angesehener, bedachter, aufrichtiger Wissenschaftler ist.
Man kann nur hoffen, dass ein solches Verhalten nicht dazu führt, dass sich Wissenschaftler zurückziehen und davon abschrecken lassen, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Mich hat es sehr getroffen, dass jemand, der mit solch einer Expertise an die Öffentlichkeit geht und wahrscheinlich seit Anfang Januar Tag und Nacht arbeitet und kein Privatleben mehr hat, so angegriffen wird für haltlose Behauptungen, denn im Endeffekt kamen aus dem Labor von Christian extrem wichtige Ergebnisse und er war der Erste, der diagnostische Tests bereitgestellt hat. Die Frage ist, wie man es besser machen kann. Dafür habe ich auch keine Idee, aber man kann nur hoffen, dass ein solches Verhalten nicht dazu führt, dass sich Wissenschaftler zurückziehen und davon abschrecken lassen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir brauchen die Wissenschaft und eigentlich ist es ja auch erfreulich, dass man in der breiten Öffentlichkeit über wissenschaftliche Ergebnisse spricht und fragt, was uns die Wissenschaft sagen kann. Ich bin sicher, dass sehr viele Leute daran interessiert sind oder dass so das Interesse geweckt worden ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Sie sind also nicht der Ansicht: Wissenschaft zurück in den Elfenbeinturm?
Nein, überhaupt nicht, wir brauchen im Moment die Wissenschaftler mehr denn je. Das Problem sind, wie wir schon am Anfang gesagt haben, die Begriffe und dass das Verständnis von Wissenschaft und Wissenschaftlern in der Öffentlichkeit nicht das gleiche ist wie das, was wir von uns haben. In der Wissenschaft herrscht das Prinzip, dass es nicht Schwarz und Weiß gibt, sondern ganz viele Grautöne dazwischen. Wir sagen nicht: »So ist es!«, sondern wägen kritisch ab. Wir können zwar unsere Einschätzung abgeben, aber Wissenschaftler sind auch nicht allwissend. Es stimmt zwar, dass man in bestimmten Bereichen das größere Fachwissen hat, aber als SARS-CoV-2 aufkam, wussten wir genauso wenig über den Erreger wie alle anderen auch. Man kann dann die anderen Coronaviren heranziehen, aber ganz viel von dem, was wir heute wissen, hat sich in den letzten Wochen und Monaten durch Forschungsergebnisse ergeben – und diese haben nicht unbedingt immer das bestätigt, was wir am Anfang angenommen haben! Das liegt daran, dass wir es mit einem neuen Erreger zu tun haben.
Wir sagen nicht: »So ist es!«, sondern wägen kritisch ab. Wir können uns immer nur ein wenig an die Wahrheit herantasten, die Wissenschaft hat kein Exklusivwissen.
In der Öffentlichkeit lässt sich ganz schlecht vermitteln, dass wir nicht eine reine Wahrheit haben, sondern nur Aussagen über aktuell vorliegende Daten treffen können. Schon ein paar Wochen später könnten neue Daten vorliegen, die die Einschätzung ändern kann. Es ist schwierig zu erklären, dass auch wir uns immer nur ein wenig an die Wahrheit herantasten können und die Wissenschaft kein Exklusivwissen hat, das anderen überlegen ist. In der Forschung gehört es dazu, dass man sich mal irrt, dass Ergebnisse widerlegt werden.
Aber die anfänglichen Unsicherheiten sind der Bevölkerung gar nicht bewusst gewesen. Sie wurden auch nicht immer kommuniziert. Die Öffentlichkeit kennt ja die wissenschaftliche Arbeitsweise nicht – wie Sie selbst sagen.
Genau das ist das Problem. Vielleicht bräuchte man gleich in der Schule ein Fach Wissenschaft oder Statistik. Auch bei Ärzten oder anderen Menschen im Gesundheitswesen wird ja gesagt, dass man diesen eine viel bessere Ausbildung geben müsste, damit sie Auswertungen besser verstehen und kritisch hinterfragen können. Ohne diesen fachlichen Hintergrund heißt es in der Öffentlichkeit: »Ach, die wissen doch selbst nicht, was die sagen, und jeder sagt etwas anderes und die widersprechen sich alle.« Doch es gehört zur Wissenschaft dazu, dass man Ergebnisse diskutiert und es verschiedene Arten geben kann, sich Daten anzuschauen. Und weil man immer so auf die Medien schimpft: Ich finde, dass die klassischen Medien sehr viele und hochwertige Arbeiten veröffentlicht haben, in denen man das Thema sehr gut erklärt hat, glaube aber auch, dass vielleicht die Bild-Zeitung und soziale Medien, wo man eben versucht, den Inhalt in drei Sätzen zusammenzufassen, Schaden angerichtet haben.
Das würden Sie als Hauptursache für diese massiven Vorwürfe sehen oder gibt es vielleicht andere? Es geht schließlich ums eigene Leben.
Das Problem ist natürlich, dass alle schnelle Antworten wollen: die Bevölkerung, die Politik (um schnell Entscheidungen treffen zu können) und wir Forscher ebenso; natürlich wollen wir wissen, ob man immun ist, wie lange die Immunität anhält, ob man vor einer Reinfektion geschützt ist, ob sich das Virus verändert, wie hoch die Todesrate ist. Dafür braucht man einfach viele Befunde und Zeit. Wir Wissenschaftler haben schon sehr schnell gearbeitet. Wir haben bereits über 20 000 Publikationen, doch selbst für Experten ist es inzwischen unmöglich, noch einen Überblick zu behalten, was eigentlich schon publiziert ist. Daneben gibt es auch Dinge, die sich nicht verkürzen lassen, also z. B. alle Fragen zur Immunität. Die können wir einfach nicht beantworten, weil wir den Erreger erst seit 6 Monaten haben. Dazu braucht man Beobachtungsstudien über ein Jahr oder vielleicht noch länger. Natürlich führt dies zu Unzufriedenheit und man denkt: »Die ganze Wissenschaft und die ganzen Forscher, ihr habt doch alle Methoden und ihr seid doch so schlau, ihr habt so viel Geld bekommen, und warum wisst ihr es denn immer noch nicht?« Das ist natürlich, weil man es einerseits selbst wissen möchte, weil man sein Leben weiterleben will, und andererseits die Corona-Krise für viele Menschen eine existenzielle Bedrohung darstellt. Und deshalb sagt man, man braucht diese Antworten jetzt. Ich glaube, man muss manchmal einfach sagen, dass wir diese Antworten noch nicht liefern können, auch wenn dies unbefriedigend auf beiden Seiten ist. Natürlich ist es schöner, wenn ich sage: »Ich glaube aber, dass es so und so ist«, aber die meisten Wissenschaftler, die ich kenne, tun sich einfach schwer mit irgendwelchen Vorhersagen, und wenn man sie trifft, begibt man sich in einen gewissen luftleeren Raum. Das sind dann persönliche Einschätzungen, die aber nicht auf Daten beruhen. Und vom Prinzip sind wir eher so ausgebildet, dass wir alle Aussagen auf Daten basieren. Man darf sich nicht verleiten lassen, vorläufige Daten zu verwenden oder zu extrapolieren, weil das einem auf die Füße fallen kann. Man darf jetzt keine Abstriche bei der Qualität machen und alles nur noch halbgar veröffentlichen, nur damit wir schnell Ergebnisse haben.
Die Virologen Drosten und Kekulé haben je einen Podcast. Hier kann man einerseits provokativ fragen, ob Virologinnen und Virologen so viel Zeit haben, andererseits könnte ein Verbund gegründet werden und so mit einer Stimme gesprochen werden.
Gut (lacht), man kann jetzt natürlich niemandem verbieten, seine Meinung kundzutun oder einen Podcast ins Leben zu rufen; es kann natürlich jeder sagen, was er möchte. Aber es gibt tatsächlich Initiativen, in Deutschland z. B. von der Gesellschaft für Virologie (GfV) – das ist die Fachgesellschaft der deutschsprachigen Virologen. Hier gibt es eine Kommission, in der auch ich Mitglied bin, die versucht, eine Konsensus-Meinung zusammenzufassen, damit die Diskussion eben nicht nur von Einzelmeinungen dominiert wird. Dazu gehört eine große Anzahl angesehener deutscher Virologen und dass man Experten für verschiedene Bereiche hat – Epidemiologen, Impfstoffforscher, Leute, die sich mit Diagnostik auskennen, und auch Leute, die vorher schon mit Coronaviren gearbeitet haben. Die Kommission gibt es noch nicht lange, doch wir versuchen aktuell, Stellungnahmen zu schreiben und zu veröffentlichen, die in einer verständlichen Sprache verfasst sind und die Konsensus-Meinung der allermeisten Virologen wiedergibt.
Ein schöner Ansatz.
Ja, das ist ein schöner Ansatz, leider auch viel Arbeit. Das Problem ist, dass es plötzlich sehr viele »Experten« gibt, die vorher noch nie mit Coronaviren gearbeitet haben. Vielleicht ist auch so ein verzerrtes Bild entstanden, weil es wenige echte Experten gibt. Viele Leute, die direkt in den Ausbruch involviert waren – die z. B. Diagnostiklabore oder infektiologische Kliniken leiten –, hatten gar keine Zeit, ihre Meinung kundzutun, und viele Leute, die nicht die erste Riege der Experten bilden, aber mehr Zeit hatten, weil sie eben nicht in den Ausbruch involviert waren, konnten deshalb Interviews geben.
Letzte Frage: Haben Sie sprach- oder kommunikationsbezogen noch eine gute Nachricht für uns – etwa zum optimalen Infoformat/-kanal?
Den Podcast fand ich schon sehr, sehr gut. Ich fand es sehr interessant, was für eine große Aufmerksamkeit er bekommen hat, weil er teilweise ja doch sehr detaillierte virologische Betrachtungen enthält. Ich bin schon recht lange Virologin und fand es ganz spannend, dass plötzlich Freunde und Bekannte, die vorher wirklich nur ganz vage eine Vorstellung davon hatten, was ich, was wir machen, plötzlich ganz begeistert waren und Wissen dadurch generiert haben. Ich würde es mir wünschen, dass man so einen Zugang zu Informationen auch zu anderen Bereichen erhält, weil ich mich oft gefragt habe: So verfälscht oder missverständlich, wie unsere Befunde in der Presse dargestellt werden, werden vielleicht auch andere Themen, von denen ich eben kein Fachwissen habe, dargestellt, und kriege nur deshalb so wenig mit, weil mir einfach der Zugang zu Informationen fehlt.
Und medizinisch?
Es verdichten sich immer mehr die Hinweise, dass man in der Regel nach einer durchgemachten Infektion Antikörper bildet und dass man wahrscheinlich auch eine zelluläre Immunität aufbaut. Es gab jetzt auch die erste Impfstoffstudie, wo man das zeigen konnte und dass sich das Virus gar nicht so stark verändert, wie man anfangs befürchtet hat. Also, die gute Nachricht ist, wir werden einen Impfstoff haben, da rauskommen und irgendwann mal wieder eine Zeit post COVID haben. Das enthielt jetzt aber keine Voraussage, wie lange das dauert.
Vielen Dank für das Gespräch.
1 Wortkreuzung aus (des)information + epidemic, die die epidemieartige Verbreitung von falschen oder Desinformationen nichtmedizinischer Akteure bezeichnet.
Prof. Dr. Isabella Eckerle
ist Virologin am Geneva Centre for Emerging Viral Diseases des Universitätsklinikums Genf und Mitglied der »ad-hoc SARS-CoV-2 Kommission« bei der Gesellschaft für Virologie e. V. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die laborgestützte Risikobewertung neuartiger und neu entstehender Viren.