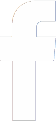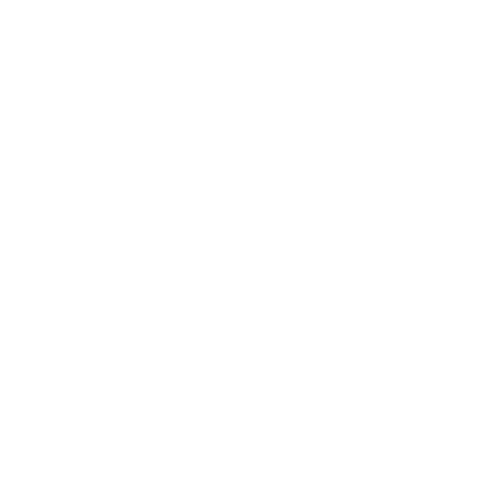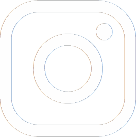Zeit-Wort: skalieren

Skalieren? Fehlt da nicht etwas? Wer bei diesem Verb an eskalieren denkt und demnach ein <e> vermisst, dem ist wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, dass sich das Wort skalieren seit einiger Zeit stark verbreitet. Zwar ist es noch nicht im Alltagswortschatz angekommen, dehnt jedoch seinen zuvor vorwiegend fachsprachlichen Wirkungskreis zunehmend aus. Eine Assoziation mit eskalieren ist indes nicht gänzlich falsch: Die Verben teilen sich einen sprachlichen Ursprung, sie sind jedoch nicht bedeutungsgleich.
Erst im kommenden Jahr lässt sich die Produktion [eines Covid- 19-Impfstoffes] auf Mengen skalieren, die Impfungen in größeren Bevölkerungsgruppen möglich machen.[1]
Unternehmen, die den Wechsel vollziehen, sind agiler, skalieren besser, haben eine kürzere Time-to- Market für ihre Anwendungen sowie eine bessere Performanz und Verfügbarkeit.[2]
Ethik skaliert nicht so einfach. Es ist schon sehr anstrengend, auch im großen Maßstab so ethisch zu sein, wie man im Kleinen ist.[3]
Suggeriert das erste Verwendungsbeispiel noch das Verständnis einer Vergrößerung, wird es beim zweiten schon schwieriger, dies herauszulesen. Das dritte macht deutlich, dass skalieren nicht nur fachsprachlich verwendet wird, sondern sich auch auf andere Bereiche ausdehnt. Um uns den unterschiedlichen Bedeutungsebenen des Verbs anzunähern, beginnen wir mit dem Naheliegendsten und leiten es vom Substantiv Skala ab; so wird es in der Psychologie und Soziologie schlicht im Sinne von ›Messwerte in eine Skala einordnen‹ verstanden. Bei einer Skala handelt es sich um die Maßeinteilung an Messgeräten, z. B. die Striche und Zahlen auf einem Zollstock oder auf einem Thermometer. Das Wort geht zurück auf italienisch scala ›Leiter, Treppe‹; insofern ist eine Skala auch als › Stufenfolge‹ zu verstehen. Daher rührt, nebenbei bemerkt, auch der Name des berühmten Mailänder Opernhauses, der Mailänder Scala – jedoch nicht, weil eine mehr oder weniger imposante Treppe zum Eingang führt, sondern weil sie am Piazza della Scala liegt, der zuvor von der Kirche Santa Maria della Scala (der Heiligen Maria von der Treppe geweiht) dominiert worden war.
Der ursprünglichen Bedeutung folgend ist eine Skala somit auch als eine Reihe zusammengehöriger, sich abstufender Erscheinungen zu verstehen, so kann sie in der Musik etwa eine Tonleiter bezeichnen, in der Kunst kann sie sich auf eine Farbabstufung beziehen. Begegnet uns das Wort in der Variante Skale, ist dies ein Indiz dafür, dass wir uns im fachsprachlichen Bereich bewegen. Dem italienischen Wort scala liegt letztlich das lateinische Verb scandere zugrunde, im Deutschen heute gebräuchlich als skandieren. Dieses trägt die Bedeutung ›Verse mit starker Betonung der Hebung sprechen‹, mehr noch ›rhythmisch und abgehackt, in einzelnen Silben sprechen‹; so verbinden wir es heute beispielsweise mit den Sprechchören bei Fußballspielen, und auch auf Demos wird häufig skandiert. Im ursprünglichen Sinne jedoch ist es als ›stufenweise emporsteigen‹ zu verstehen.
Damit zurück zu unserem Zeit-Wort: Die Wortgeschichte verrät uns also, dass dem Verb skalieren eine Bewegung zugrunde liegt, und zwar stufenweise ab- oder (mehr noch) aufwärts. Die einfache Bedeutung ›in eine Skala einordnen‹ trägt dem jedoch nur bedingt Rechnung. Präziser wird es im Bereich der IT: Dort skaliert etwa eine Software und passt sich der Leistungsfähigkeit der Hardware an; skaliert man ein Bild, so vergrößert oder verkleinert man es, behält dabei jedoch die Proportionen bei. Skalieren bezeichnet also nicht speziell eine Vergrößerung, wie zuvor suggeriert wurde, sondern grundsätzlich eine Anpassung der Größe unter Beibehaltung der Proportionen bzw. des Maßstabs, sei es ein Vergrößern oder ein Verkleinern. Diese Anpassung hängt dabei stets von einer Veränderung der Rahmenbedingungen ab. Ganz plakativ: Wird ein kleinerer oder ein größerer Bilderrahmen als bisher verwendet, so ist auch das Bild in seiner Größe diesem Rahmen anzupassen – eben zu skalieren.
Spezifischer wird es beim Verb eskalieren: Dieses ist als ›sich (allmählich) steigern, verschärfen, ausweiten‹ zu verstehen, es ist also stets eine Aufwärtsbewegung, eine Verstärkung oder eine Vergrößerung impliziert. So eskaliert etwa ein Disput zu einem Streit. Gleichzeitig kann eskalieren bedeuten, etwas ›einer höheren Stufe in der Hierarchie der Entscheidungsträger zuzuführen‹, beispielsweise eine Budgetentscheidung an den Vorgesetzten weiterzugeben, statt sie selbst zu treffen. Wie skalieren geht jedoch auch eskalieren, Eskalation letztlich auf italienisch scala und somit lateinisch scandere ›skandieren‹ zurück, es hat jedoch den Umweg über das Französische genommen: Dort bedeutet escaliers ›Treppe‹, im Mittelalter bezeichnete eine escalade, italienisch scalata, die ›Stürmung einer Festung mit Sturmleitern‹ – auch dies eine Aufwärtsbewegung implizierend.
Eine weitere Gemeinsamkeit von eskalieren und skalieren findet sich in der Grammatik: So werden beide Verben sowohl intransitiv als auch transitiv verwendet, also nur mit einem Subjekt oder zusätzlich mit einem Objekt. Intransitiv: Ein Streit eskaliert; ein Unternehmen skaliert (passt beispielsweise seine Produktion an äußere Gegebenheiten an). Transitiv: Zahlreiche Kundenbeschwerden eskalieren die internen Unstimmigkeiten; das Unternehmen skaliert die Produktion (und passt sie z. B. einer großen Nachfrage an).
Sowohl skalieren als auch eskalieren weisen also auf eine Art Bewegung hin. Eskalieren ist dabei jedoch oft eher negativ konnotiert und beinhaltet eine Intensivierung, während skalieren eher neutral auf eine Anpassung der Größe hinweist.
Insbesondere im Bereich der Wirtschaft begegnet uns skalieren in den letzten Jahren vermehrt und hier auffallend häufig in Bezug auf ein Unternehmenswachstum oder die Effizienz von Geschäftsprozessen. Dies hängt vermutlich mit dem Einfluss des Englischen zusammen, der gerade in diesem Bereich sehr spürbar ist – dort etwa (to) scale, scalable capital. Und doch ist auch eine gewisse Emanzipation des Verbs zu beobachten: So wird es zunehmend auch außerhalb des wirtschaftlichen Kontexts verwendet und es findet sich inzwischen auch metaphorisch, beispielsweise in Bezug auf eine Persönlichkeitsentwicklung, den Umgang mit Herausforderungen oder die Übernahme von Verantwortung (so auch im dritten Verwendungsbeispiel). Gerade hieraus ist abzuleiten, dass skalieren nicht immer mit einer Vergrößerung oder Verbesserung in Zusammenhang steht, sondern viel allgemeiner mit einer Anpassung an Herausforderungen und dem Umgang damit. Dies wiederum ist ein Zeichen unserer Zeit, unserer heutigen Gesellschaft, und so ist es nicht verwunderlich, dass ein Blick in die Verlaufskurve des Wortvorkommens einen sprunghaften Anstieg der Häufigkeit seit ca. 2018 (vgl. dwds.de) zeigt. Gleichzeitig ist das Wort noch vergleichsweise wenig verbreitet und seine Bedeutung schwer greifbar; auch wenn es aktuell »skaliert«, ist nicht auszuschließen, dass es für den Alltagswortschatz zu speziell, zu elitär bleibt und somit letztlich als Modewort wieder verschwindet.
Und dennoch: Mit diesem Wissen sollte der eine oder die andere nun darauf vorbereitet sein, dem bislang bekannteren Verb eskalieren auch ohne <e> zu begegnen. So tragen diese Ausführungen vielleicht dazu bei, mögliche Beschwerden über falsche Sprachverwendung in Zeitungsartikeln zu skalieren.
1 Süddeutsche Zeitung, 10.11.2020.
3 https://www.businessinsider.de/gruenderszene/perspektive/krisenmanager-fynnkliemann-de/.
4 Interessant: Skalation ist eher unüblich, während Skalierung und Eskalierung gleichermaßen frequent scheinen.
Frauke Rüdebusch