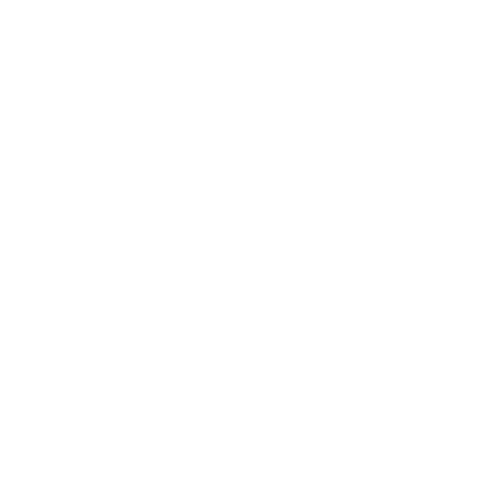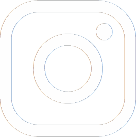Geschlechtergerechte Sprache im Land der Académie française
Von Vincent Balnat
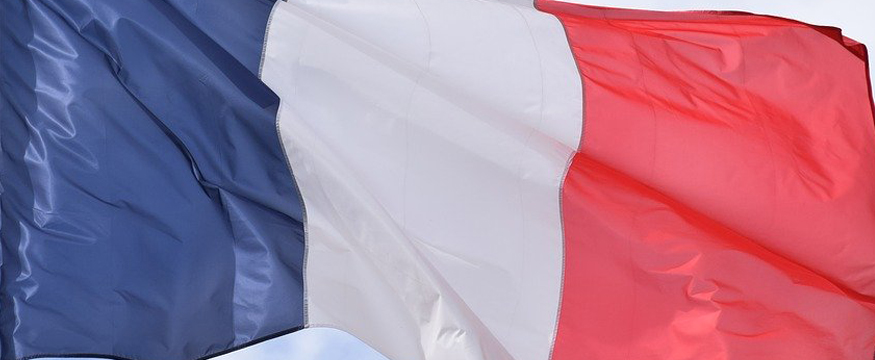
Gekürzte Fassung
Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um eine Kurzfassung des gleichnamigen Beitrags im Sprachdienst 1–2/2020, einem Themenheft zur Problematik der geschlechterbewussten Sprache. Hier geht es zum Inhaltsverzeichnis.
Sie können dieses Heft über uns beziehen oder eine Kopie des vollständigen Aufsatzes bestellen. Beides ist sowohl als Printversion als auch digital als PDF erhältlich.
Nicht nur in Deutschland ist die bessere Sichtbarkeit von Frauen in der Sprache ein seit Jahrzehnten umstrittenes Thema. Auch im französischen Sprachraum haben die Forderungen nach einem geschlechtergerechten Sprachgebrauch seit den 1970er Jahren immer wieder heftige – und zum Teil aggressive – Diskussionen ausgelöst. Im Kern geht es darum, die Vormachtstellung des »generischen« Maskulinums abzuschaffen und eine von Kindesbeinen an erlernte Grammatikregel aus den Köpfen zu verbannen: «Le masculin l’emporte sur le féminin« (›Das Maskulinum hat stets Vorrang vor dem Femininum‹). Diese Regel besagt, dass sämtliche Pronomina und Adjektive bei Pluralformen im Maskulinum zu verwenden sind, selbst wenn man Eigenschaften einer Gruppe von 999 Frauen und einem Mann benennt: Ces 999 femmes et cet homme sont intelligents (nicht *intelligentes).
In der öffentlichen Debatte um die so genannte »écriture inclusive« (›inklusive Schreibweise‹), vermutlich eine Lehnübertragung von engl. inclusive writing bzw. (gender-)inclusive language, lassen sich grundsätzlich zwei Schwerpunkte ausmachen, die sich keineswegs nur auf die Schrift beschränken. Der erste betrifft die Feminisierung der Berufs- und Amtsbezeichnungen. Während feminisierte Bezeichnungen wie députée und chirurgienne schon in den 1970er Jahren in Quebec, sodann in Belgien, Luxemburg und der Schweiz ohne Weiteres Eingang in die Behördensprache fanden, hielt man in Frankreich noch lange an den männlichen Formen fest. Die Académie française, die als oberste Hüterin der französischen Sprache gilt, stemmte sich vehement gegen diesen aus ihrer Sicht unzulässigen Eingriff in die Lexik und Grammatik; diese strikte Ablehnung fiel in den 1980er und 1990er Jahren, als der öffentliche Diskurs noch stärker von Spott und Chauvinismus beherrscht war, auf fruchtbaren Boden. Erst mit dem Regierungswechsel 1997 und der Forderung mehrerer Ministerinnen der sozialistischen Partei, als Frauen angeredet zu werden, wurden feminisierte Berufs- und Amtsbezeichnungen in amtliche Texte eingeführt, deren Verwendung sich dann in der Presse schnell durchsetzte. Die Académie ließ dagegen erst im Februar 2019 verlautbaren, sie sehe »prinzipiell keine Hindernisse für die Feminisierung von Berufsbezeichnungen«.[1]
Der zweite Schwerpunkt betrifft die Syntax und die Rechtschreibung. Anders als im Deutschen richten sich im Französischen attributive und prädikative Adjektive in Genus und Numerus nach dem Substantiv; ähnlich kongruieren Partizipialformen im Passé composé mit être mit dem Subjekt. Infolgedessen lässt sich in manchen Äußerungen nahezu jedes lexikalische Element gendern: Les correspondants allemands et correspondantes allemandes sont arrivés (arrivées) fatigués (fatiguées) (›Die deutschen Austauschschüler/-innen kamen müde an‹). Zur Vereinfachung wurde vorgeschlagen, die bis ins 18. Jahrhundert geltende Regel des »accord de proximité« wieder einzuführen, nach der das Genus des nächststehenden Substantivs maßgeblich ist: Les Allemands et les Allemandes sont arrivées fatiguées.
Um Doppelformen wie Allemand et Allemande zu vermeiden, werden seit über 20 Jahren verschiedene grafische Abkürzungsmittel eingesetzt: Großschreibung (AllemandE), Binde- oder Schrägstrich (Allemand-e, Allemand/e), Klammern (Allemand(e)), Punkt (Allemand.e), neuerdings auch der aus dem Katalanischen übernommene »Mittelpunkt« (Allemand·e). Als derartige Abkürzungen 2017 erstmals in einem Schulbuch auftauchten, löste dies eine monatelange Welle der Empörung aus; Kritiker, allen voran die Académie, wetterten gegen den ›inklusiven Irrweg‹ (»aberration inclusive«), eine ›tödliche Gefahr‹ (»péril mortel«) für die Nationalsprache.[2] Die Auseinandersetzung zwischen Befürwortern und Gegnern der écriture inclusive spitzte sich derart zu, dass Premierminister Edouard Philippe im November 2017 intervenierte und die Verwendung dieser Formen in amtlichen Texten untersagte.
Wie ist nun der Einfluss solcher Vorschriften von »oben« auf die Praxis der écriture inclusive einzuschätzen? Sprachwandel ist bekanntlich eine Folge des Sprachgebrauchs, und dieser lässt sich nur bedingt vorschreiben. Laut einer 2017 durchgeführten Meinungsumfrage sind ca. drei Viertel der Franzosen und Französinnen für eine bessere Sichtbarkeit von Frauen in der Sprache.[3] Insofern ist es nicht erstaunlich, dass die écriture inclusive trotz des Verbots von Premierminister Philippe in formellen Kontexten um sich greift. Anreden wie Chers et chères collègues und ihre abgekürzten Varianten Cher.e.s, Cher-e-s, Cher/e/s, cher(e)s und CherEs collègues sind inzwischen an der Universität geläufig, ebenso wie Cher.e.s abonné.e.s, adhérent.e.s und sympathisant.e.s in der Kommunikation von Firmen, Vereinen und Gewerkschaften. Ob ähnliche Formen sich dauerhaft auch in weniger formellen Kontexten durchsetzen, bleibt abzuwarten. Eines ist sicher: Weder die Politiker noch die Académie française werden diese Entwicklung beeinflussen können.
[1] »[…] il n’existe aucun obstacle de principe à la féminisation des noms de métiers et de professions. Celle-ci relève d’une évolution naturelle de la langue, constamment observée depuis le Moyen Âge« (La féminisation des noms de métiers et de fonctions, Bericht der Académie française, Paris 2019).
[2] Déclaration de l’Académie française sur l’écriture dite »inclusive« adoptée à l’unanimité de ses membres dans la séance du jeudi 26 octobre 2017.
[3] https://harris-interactive.fr/opinion_polls/lecriture-inclusive; Zugriff am 7.7.2019.