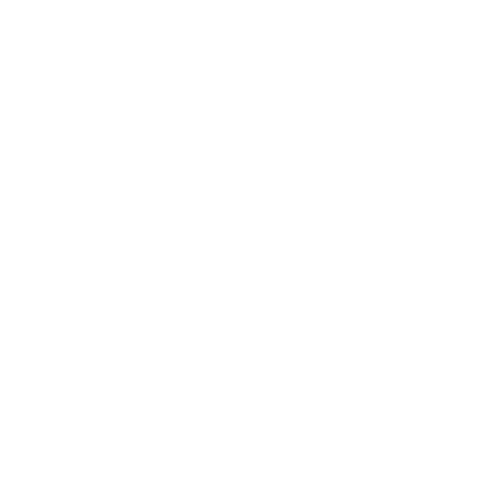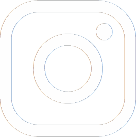Dankesrede von Marietta Slomka
»Was für ein schöner Samstag!« Dass Sie alle jetzt mit diesem Satz sofort eine bestimmte Assoziation haben, einen bestimmten politischen Redner in einer bestimmten Situation vor Ihrem inneren Auge sehen – das gehört zu dem, wozu ich gleich gern ein paar Worte sagen möchte. Ein paar Beobachtungen zur politischen Kommunikation hierzulande.
Aber natürlich nicht ohne mich vorab bedankt zu haben. Bei der Gesellschaft für deutsche Sprache und ihrer Jury. Wenn man tagtäglich mit Sprache arbeitet, wenn das der Instrumentenkasten ist, in den man greift, wenn man Sprach-Arbeiter ist – und ich mag dieses Wort, denn so sehe ich mich, ich bin Sprachhandwerkerin: Feilen, Hobeln, Anmalen, Verkaufen. Und ich liebe es. Wenn man also mit Sprache arbeitet, die deutsche Sprache liebt, kann es nichts Schöneres geben, als dafür gerade von Ihnen ausgezeichnet zu werden, diesen Preis verliehen zu bekommen. Ich habe mich wirklich unheimlich darüber gefreut. Danke!
Und ich danke natürlich auch Nikolaus Brender – nicht nur für diese Laudatio. Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Menschen, die das eigene Leben nachhaltig beeinflussen, denen man in diesem Sinne tatsächlich etwas verdankt. Dabei erinnere ich mich an unsere allererste Begegnung, Herr Brender, an die Sie sich aber hoffentlich nicht mehr so gut erinnern wie ich!
Sie müssen sich das so vorstellen: junge Korrespondentin, sitzt abends in ihrem Berliner Büro vorm Computer, denkt, sie hat den Tag so weit hinter sich, und beschäftigt sich gerade hingebungsvoll damit, ihren virtuellen Garten zu gießen. Das war so ein Link, den einer unserer Grafiker rumgemailt hatte. Man konnte damit aus seinem Computer-Bildschirm interaktiv eine blühende Landschaft machen, ganz individuell gestaltet. Sie dürfen nicht vergessen: Nicht nur ich war damals ca. 13 Jahre jünger, auch das Internet war es. Ein Faszinosum, gerade für meine Generation, die noch ganz ohne Handy und Netz aufgewachsen war und lange Zeit Tetris-Spielen für das höchste der Computer-Gefühle hielt. Und dann explodierte plötzlich dieses Netz und es gab die tollsten Sachen und damit war natürlich auch das Tor zu unendlichen Infantilisierungsprozessen eröffnet, die auch vor einer ernsthaften Parlamentskorrespondentin durchaus nicht Halt machten.
In diesem Sinne toll war also auch dieser virtuelle Schrebergarten, der aber den kleinen Nachteil hatte, insofern real zu sein, dass er tägliche Versorgung verlangte: Gießen, Düngen, Jäten. Ich zog also gerade per Mausklick eine kleine virtuelle Gießkanne auf mein liebevoll angelegtes Rosenbeet, als sich hinter mir jemand räusperte. »Guten Abend. Brender ist mein Name. Stör ich Sie?« Das war also der neue Chefredakteur, der in Berlin durchs Hauptstadtstudio stapfte, um seine Mitarbeiter kennenzulernen. Ich habe mich dann sehr bemüht, meinen wild blühenden Bildschirm irgendwie zu verbergen, während Herr Brender über meine Schulter auf meine Rosenbeete kuckte und dann verfolgen konnte, wie eine Garnison mit Schäufelchen bewehrter Gartenzwerge von links oben des Bildschirms nach rechts unten marschierte. Während die Zwerge mit ihren Schaufeln durch meine Beete pflügten und ich die vage Hoffnung hegte, Herr Brender möge sie für Mainzelmännchen halten, im Sinne der Corporate Identity, wandte er mir wieder den Blick zu und fragte: »Sagen Sie, Frau Slomka, wann haben Sie denn eigentlich das letzte Mal eine investigative Geschichte ausgegraben?«
Nichts deutete bei dieser ersten Begegnung darauf hin, dass der neue Chefredakteur mir einige Monate später mitteilen würde, er habe beschlossen, dass ich die neue Frau im heute-journal werden solle. Womit er bei mir damals einen mittleren Herzinfarkt auslöste. Aber so war das mit Herrn Brender: Er war sehr gut darin, überraschend zu sein. Einigen Mitgliedern der politischen Klasse dieses Landes war das dann ja bekanntlich auch zu viel der Unberechenbarkeit.
Zurück zum schönen Samstag bzw. Sonntag und der Sprache unserer Politiker. Ich möchte nun natürlich keinesfalls Professor Armin Burkhardt Konkurrenz machen, der hierzulande ja der Vorreiter ist im Bereich der polito-linguistischen Sprachkritik. So wissenschaftlich und systematisch kann und will ich es gar nicht angehen. Es sind nur ein paar kleine Beobachtungen aus meiner alltäglichen Arbeitswelt, die mich umtreiben: Warum wird so gesprochen, wie gesprochen wird?
Warum ist es so, dass meine Kollegen in der Regie nach aufgezeichneten Politiker-Interviews oft sagen: »Weißt du, das Nachgespräch war das Interessanteste. Schade, dass man das nicht senden kann.« Das Nachgespräch ergibt sich dadurch, dass wir Interviews oft schon um 20.00 Uhr aufzeichnen, so ergibt es sich eben, dass man dann noch ein paar Minuten hat, in denen die Kollegen aus der Regie die technische Qualität der Aufzeichnung prüfen, und natürlich schweigt man sich in der Zeit nicht stur an, sondern redet noch ein bisschen weiter. Vorausgesetzt, das Gegenüber ist nach dem Interview noch in Plauderlaune … Bei diesen Nachgesprächen jedenfalls ist der Politiker plötzlich wieder Mensch. Redet völlig normal, der ganze Duktus, ja selbst die Körperhaltung ist wie ausgewechselt. Da geht’s dann auch viel offenherziger zu – ohne dass dabei Geheimnisverrat begangen würde. Aber das »Wie« – das ist völlig anders.
Diese Erfahrung habe ich im Laufe der letzten 15 Jahre, die ich beim Fernsehen arbeite, immer wieder gemacht. Dass »die« hinter den Kulissen oft so ganz anders sind. Nicht nur Politiker. Das ist ein generelles Phänomen im Fernsehen, dass die Protagonisten »in natura« häufig anders rüberkommen als auf dem Bildschirm. Übrigens gilt das offenbar auch für mich selbst, wie mir schon oft genug mitgeteilt wurde. Was einen dann auch nicht immer freut. Wenn Sie beim Kaufhof an der Käsetheke stehen und die Kundin neben Ihnen greift Ihnen zwischen Appenzeller und Gouda in den Arm und sagt: »Also Frau Slomka, in natura sehen Sie ja viel jünger und netter aus«, hält sich die Freude durchaus in Grenzen! Ich nehme mich selbst da also gar nicht aus, ich weiß nur zu gut, dass es nicht ganz leicht ist, vor einer Kamera – sprich: vor einem unsichtbaren Millionenpublikum – zu stehen, in einer Rolle, in der man immer sehr aufpassen muss, was man sagt, und dann trotzdem noch total natürlich, authentisch und spontan zu sein. Insofern will ich auch gar nicht wohlfeil lästern über das meiner Beobachtung nach zunehmende Unvermögen der politischen Klasse zur massenmedialen Kommunikation, sondern frage mich: Muss das so sein?
In Deutschland gibt es meiner Beobachtung nach generell einen besonders großen Unterschied zwischen privater und öffentlicher Sprache, größer als etwa im Angelsächsischen. Bei Politikern ist das besonders problematisch, denn das Publikum, mit dem sie via Massenmedien kommunizieren, macht ja durchaus keinen Unterschied zwischen privatem und öffentlichem Zuhören. Jedenfalls nicht, wenn man mit der Chips-Tüte auf dem Fernsehsofa sitzt. Und da geht es nicht nur um die berühmten und häufig zitierten Politsprech-Euphemismen. Diese Standard-Vokabeln, die beschönigen und unliebsame Assoziationen vermeiden. Die vielen Arbeitskräfte etwa, die sich immer wieder darauf freuen, endlich freigesetzt zu werden. Blöd nur, wenn sie sich dann doch, wie etwa die Schlecker-Frauen, um eine »Anschlussverwendung« bemühen müssen, wie Herr Rösler letztens feststellte.
Aber es geht mir nicht nur um diese sprachlichen Beschönigungen. Was mich immer wieder irritiert, ist diese anti-emotionale, selbstdistanzierte und substantivistische Gremiensprache. Politiker mögen, um beispielsweise Andrea Nahles zu zitieren, ein »durch institutionalisierte Kooperation begründetes Vertrauensnetz« schätzen. Vertrauen bei der Bevölkerung gewinnt man mit einer solchen Sprache eher nicht.
Ich persönlich bin der Überzeugung: Wer sich nicht klar ausdrückt, hat entweder keinen klaren Gedanken bzw. die komplexe Materie selbst nicht richtig verstanden (das ist gern auch im Journalismus anzutreffen) oder will problematische Inhalte verschleiern oder er/sie will Banales aufpumpen (pimp your thoughts). Ein Phänomen, das übrigens auch in unserer akademischen Welt anzutreffen ist. Klar, jedes Fachpublikum, jede Community, hat nun mal ihre eigenen Codes und darf sie ja auch haben. Auch die elitäre Fachsprache hat ihre Berechtigung und ihren Platz im deutschen Sprachraum. Die Frage ist nur, wie weit wir es hierzulande treiben, mit diesen linguistischen Parallelgesellschaften.Ich habe zum Beispiel einer befreundeten Professorin, mit sehr interessantem Fachgebiet, einmal vorgeschlagen, ein populärwissenschaftliches Buch zu schreiben, so à la Richard David Precht. Da schlug sie nur die Hände überm Kopf zusammen und sagte: »Um Gottes willen, wenn ich so etwas machen würde, wäre ich in meinen Kreisen sofort unten durch.« Ist das nicht eigentlich schade? Ich selbst hatte in der Hinsicht mein ganz persönliches Erweckungserlebnis, als ich nach dem Grundstudium ein Jahr an eine britische Universität ging und feststellen musste: Auf Englisch verstand ich Karl Marx viel besser als auf Deutsch! Das hat mir dann doch zu denken gegeben … Die Angelsachsen haben jedenfalls keine Angst davor, dass sie Gedanken entwerten, wenn sie sie verständlich oder gar witzig formulieren. In Deutschland macht man sich damit schnell verdächtig.
Noch einmal zurück zu Gaucks schönem, einprägsamen Sonntag. Warum hören ihm die Leute so gerne zu? Was macht das Gauck’sche Rhetorikgesetz aus? Es sind nach meiner Beobachtung drei Dinge: Erstens, die Emotion, also die Verbindung des Emotionalen mit dem Kognitiven, was generell eine gute Idee ist, weil das Emotionale ja als Verstärker und Türöffner für das Sachlich-Inhaltliche wirken kann. Zweitens, die Anekdote. Das Narrative. Das Beispielhafte, das für das Allgemeine steht. Und drittens: Er verwendet fast durchgehend die Ich-Form: »Ich fühle, mir geht es so, dass …« Er versteckt sich nie hinter dem selbstdistanzierten Neutrum »man«, das »man« so oft hört, sobald Menschen offiziell werden. Wohin man blickt und hört: Überall sind die »mans« unterwegs. Das »Ich« trauen sich viele nicht.
Beispielhaft ist insofern ein Auftritt Gaucks in der ZDF-Sendung »Was nun?«: Da wurde ihm die Frage gestellt, warum Frau Merkel ihn nicht wollte. Heikle Frage, da kann man schnell was Falsches sagen. Seine Antwort: »Ich weiß es nicht. Ich kann ihr auch nicht hinter die Stirn schauen. Wir haben uns aber in die Augen gesehen. Und ich weiß: Wir können uns vertrauen.« Mit diesem Rhetorikstil, der allein durch die Wahl des Personalpronomens Offenheit vermittelt, schaffte er es, im Laufe des Gesprächs sogar noch unangenehmere Frage zu umschiffen.
Wenn wir davon ausgehen, dass Glaubwürdigkeit die wichtigste Währung jedes Politikers ist, dann, finde ich, trauen sich Politiker zu selten, Emotionen zu formulieren. Beispiel Angela Merkel. Typisches Zitat von ihr: »Die Wiedervereinigung ist gelingbar und gelungen.« Da wünscht man sich fast Kohls blühende Landschaften zurück! Was ja eigentlich eine sehr schöne Formulierung war, sehr plakativ, fast poetisch. Das Problem war nur: Sie kam von Kohl. Und: Die blühenden Landschaften entstanden nicht innerhalb von 12 Monaten – und längere Zeiträume sind in unserer medialen Welt nicht vorgesehen. Das kurzfristige Denken, das wir Politikern, Bankern und Managern so gern vorwerfen, haben wir selbst ja auch.
Merkel kann aber übrigens auch einfach: Zitat: »Wer sich mit den Details des Saarlands befasst, erkennt, dass das Saarland das Saarland ist«. Tja. Wer wollte ihr da widersprechen!
Schlimmer wird diese krampfhafte Versachlichung, wenn es um Themen geht, die wirklich Angst machen. Wenn es um Leben und Tod geht. Als amerikanische Militärs in Afghanistan Dörfer bombardiert und dabei auch Frauen und Kinder getötet hatten, sagte der frühere Verteidigungsminister Franz Josef Jung in einem Fernsehinterview: »Bei Kampfhandlungen ist darauf zu achten, dass die Zivilbevölkerung nicht einbezogen wird, weil das kontraproduktiv ist.« Diese trockene Sprache lässt die Dinge vielleicht weniger blutig erscheinen, als sie sind. Aber sie überzeugt nicht. Kein Wunder, dass dann sein Nachfolger Karl-Theodor zu Guttenberg schon allein dafür bejubelt wurde, dass er das Wort »Krieg« in den Mund nahm.
Guttenberg, der ja so gern als charismatischer Rhetoriker gefeiert wurde, konnte übrigens auch anders. Da gibt es folgendes Zitat, das ich Ihnen in seiner vollen Schönheit nicht vorenthalten will. Es ging in dem Fall nicht um Krieg, sondern um bayerische Kommunalpolitik, um die sogenannte Regionalplanung:
»Geschuldet ist diese herausgestellte Verantwortung dem Umstand, dass das Faktum regionaler Unterschiede und Besonderheiten kaum Lösungen für die gesamtdeutsche Herausforderung erlaubt. Entsprechend sind also auch kommunale, an die Regionen und ihre Eigenschaften adaptierbare, strategische Konzepte notwendig, um den durch die demografische Entwicklung gestellten Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.« Ich weiß natürlich nicht, ob er das wirklich selbst geschrieben hat. Es stand aber sein Name darunter.
Diese eigenartig entrückte Sprache findet sich übrigens nicht nur bei den etablierten Parteien. Auch das Wahlprogramm der Piraten ist komplett in diesem Duktus geschrieben. Etwa beim Thema Urheberrecht, dem Kernthema der Partei also: »Die Rückführung von Werken in den öffentlichen Raum ist daher nicht nur berechtigt, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit der menschlichen Schöpfungsfähigkeiten von essentieller Wichtigkeit.« Mitreißend ist anders.
Was mich umtreibt: die Selbstverständlichkeit, mit der dieser substantivistische Gremien-Stil angewandt wird, eben nicht nur in verschrifteter Form, in Wahlprogrammen, sondern auch in Fernseh-Interviews, im heute-journal, das dem Politiker doch eigentlich eine gute Plattform zur politischen Kommunikation mit einem Millionenpublikum bieten würden. Doch diese Chance bleibt immer wieder ungenutzt.
So antwortete etwa die frühere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt auf meine Frage, was denn nun der wichtigste Punkt ihrer Reformpläne sei, wie folgt: »Das Kernstück des Risikostrukturausgleichs ist der Aufbau von Desease-Management-Programmen und die Einrichtung eines Risiko-Pools für besonders hohe Ausgaben besonders für kranke Menschen, die die Kassen haben.« Wohlgemerkt: Das war eine SPD-Ministerin. Die Partei des kleinen Mannes. Für den das Thema Krankenversicherung ein sehr wichtiges ist. Aber mit dem kleinen Mann oder der kleinen Frau zu kommunizieren, darin sind die Sozialdemokraten nicht besser als die Vertreter anderer Parteien.
Typisch ist in der Hinsicht auch ein Schaltgespräch mit unserem Finanzminister zur Griechenland-Rettung. Das war, als Griechenland erstmals Antrag auf Finanzhilfe gestellt hatte. Meine Frage lautete: »Sie haben vor kurzem noch gesagt: Wir Deutschen können nicht für Griechenlands Probleme zahlen. Aber genau das machen wir doch jetzt, oder?« Darauf Wolfgang Schäuble: »Nein, wir beteiligen uns gegebenenfalls, wenn ein glaubwürdiges Sanierungsprogramm mit dem IWF und der EZB und der Europäischen Kommission vereinbart ist, an einem Kredit der Euro-Gruppe für Griechenland durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau.« IWF und EZB und KFW und Euro-Gruppe in einem Satz rauszudonnern und davon auszugehen, dass jeder direkt weiß, wer da wer ist und welche Aufgaben übernimmt?
Es sind diese kleinen, alltäglichen, unspektakulären Sprachbarrieren, die mich beschäftigen. Ich glaube gar nicht, dass es dabei immer um bewusste Verschleierung geht. Oft sind das eher Nachlässigkeiten – man hat sich den ganzen Tag mit Fachleuten unterhalten, und dann abends im TV-Interview umzuschalten und normalverständlich zu reden, fällt schwer.
In anderer Hinsicht bezeichnend ist, wie zum Beispiel Kurt Beck auf einem SPD-Parteitag sagte, man müsse darüber reden, »wie die soziale Dimension des Lebens realistisch und nicht nur illusionistisch in die Zukunft getragen werden könne«. Zu sagen: Wir müssen darüber reden, wie viel Sozialstaat wir uns noch leisten können, würde wohl zu banal klingen. Möglicherweise sprach er aber auch deshalb so, weil er ein Jahr zuvor erfahren hatte, was man auslöst, wenn man unbedacht von einem »Unterschichtenproblem« spricht, wobei er den Begriff übrigens eigentlich nur zitiert hatte.
An der Stelle muss ich mich dann als Medienvertreterin auch fragen, welchen Beitrag wir dazu leisten, dass Politiker so reden, wie sie reden. Nicht falsch verstehen: Der Begriff Unterschicht geht natürlich wirklich nicht. (Bezeichnend übrigens, dass ich das jetzt selbst nochmal betonen muss! Auch ich sichere mich also ab, kaum dass ich öffentlich rede …) Aber es ist schon so, dass die Medien sich auf jeden Satz, jedes Wort stürzen, das aus der glattgefeilten Allgemein-Soße heraussticht. Andererseits ist das auch ein bisschen wie bei der Frage nach dem Huhn und dem Ei: Was war zuerst da? Reden Politiker deshalb so vorsichtig oder ist es umgekehrt: Weil es so wenig authentische Sprache gibt, wird alles, was nach Klardeutsch klingt, quasi zur Sensation?
Am anderen Ende der Skala liegt das, was ich als Pseudo-Authentizität bezeichnen würde. Wenn sich ein Politiker überlegt: Jetzt bin ich aber mal so richtig schön volksnah. Jetzt geb’ ich dem Affen aber mal Zucker! Das geht dann gerne auch furchtbar schief. Etwa wenn Sigmar Gabriel im Dezember 2010 den Truppenbesuch des damaligen Verteidigungsministers Guttenberg nebst Gattin in Afghanistan kommentierte und sagte: »Ich finde, da fehlt nur noch Daniela Katzenberger. Dann hätten auch die Soldaten etwas davon.«
Natürlich haben Politiker recht, wenn sie häufig sagen: »Es gibt leider keine einfachen Antworten in einer immer komplizierter werdenden Welt.« Das stimmt. Aber auch das Komplizierte verdient es, in eine klare Sprache gefasst zu werden. Das ist natürlich auch eine der vornehmsten Aufgaben von Journalisten. Wir sind da auch Wanderer zwischen den Welten, Vermittler im Prozess der politischen Kommunikation. Aber wir sind auch keine Dolmetscher. Politiker müssen sich schon selbst die Frage stellen, wie sie zum Volk sprechen.
Ich würde mir da wünschen, dass sie häufiger mehr Kommunikation wagen. Mehr deutsche Sprache wagen. Mehr Klartext wagen. Und das bitte nicht nur, wenn sie gerade auf dem Weg zum Emir sind … Vielen Dank!
(Quelle: Dankesrede von Marietta Slomka zur Verleihung des Medienpreises für Sprachkultur der Gesellschaft für deutsche Sprache am 5. Mai 2012 in Wiesbaden)