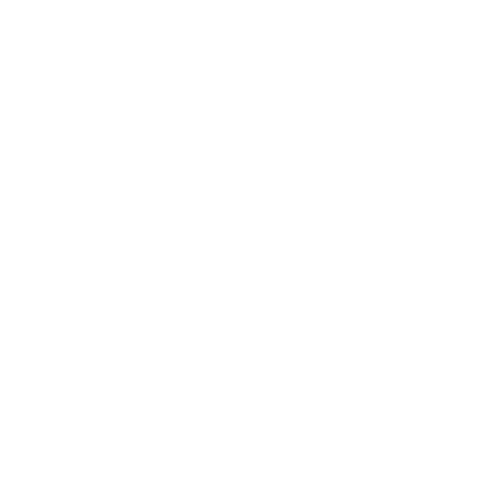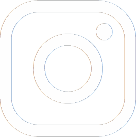Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod
Bastian Sick. Köln: Kiepenheuer & Witsch, und Hamburg: SPIEGEL ONLINE GmbH, 5. Aufl. 2004. 230 Seiten. ISBN 3-462-03448-0 (= KiWi, 863). 8,90 €
In den deutschen Mundarten ist er schon »ein alter Hut«: meinem Vater sein Hut, aber mehr und mehr setzt sich der Dativ gegenüber dem Genitiv auch in der Schriftsprache und in der gesprochenen Hochsprache durch: »Wir gedenken dem großen Gelehrten«, »wegen dir habe ich das getan«, oder als Appositionskasus: »im Gesamtwerk Friedrich Schillers, dem großen deutschen Dichter« usw. Vielleicht wird dieser »falsche« Dativ einmal zur Norm, also »richtig«, denn die Sprache und die Sprachnormen sind veränderlich, und eines Tages fallen diese Dative niemand(em) mehr auf. Aber noch dürfen wir uns gegen diese Entwicklung sträuben, solange sie einer Vielzahl Deutsch Sprechender und Schreibender missfällt.
Mit dem Titel und dem einleitenden Artikel Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod wirft der Verfasser dieses Taschenbuches ein Schlaglicht auf einen Kreuzweg im »Irrgarten der deutschen Sprache«, und er verteidigt darin die Vorfahrt des Genitivs. Das ist ganz in meinem Sinne, und es werden ihm – hoffentlich – noch viele andere Leser (einschließlich der Leserinnen, s. S. 168–172) zustimmen und sich dementsprechend verhalten. Doch es geht nicht nur um Genitiv oder Dativ, sondern noch um viele andere Zweifelsfälle im Gebrauch der deutschen Gegenwartssprache; denn das Büchlein versammelt die Sprachglossen der wöchentlich erscheinenden SPIEGEL-ONLINE-Kolumne »Zwiebelfisch«. Da geht es zum Beispiel auch um den wachsenden Missbrauch des Apostrophs, die übersteigerten Superlative (bestgekleidest), das »Elend mit dem Binde-Strich«, die Bildung der Mehrzahl von Wörtern italienischer oder englischer Herkunft (Pizzen, Espressi; Handys, Babys, Storys usw.), das überflüssige Genitiv-s in Zusammensetzungen (Essensmarke, Schadensersatz)
Das alles ist in sehr unterhaltsamer Weise und ohne erhobenen Zeigefinger erzählt. Man muss dem Verfasser nicht unbedingt in jedem Punkte folgen, sondern soll mitdenken, nachdenken, sich Anregungen holen. Ich halte beispielsweise die Wendung das macht keinen Sinn/Unterschied schlicht für eine stilistische Variante von das hat/ergibt keinen Sinn, ist kein/bewirkt keinen/führt zu keinem Unterschied und bin auch nicht sicher, ob der Gebrauch von machen in diesen Fällen wirklich ein echter Anglizismus ist, schließlich haben das Englische und das Deutsche gemeinsame sprachliche Wurzeln. Wahrscheinlich ist auch etwas erinnern (»ich erinnere das nicht«) eher ein Regionalismus – wie das österreichische erinnern auf etwas – als ein Anglizismus, wie schon Paul Kretschmer in seiner Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache (1918; 2. Aufl. 1969, S. 8 und 598) mit Verweis auf dänisch jeg erindrer dat feststellte, und man könnte auch noch niederländisch ik herinnere dat (niet) dazustellen. Visa als Einzahl dagegen (SICK, S. 51 f.) geht sicherlich auf englischen Einfluss zurück.
Wenn man sich erst einmal auf die Thematik des Büchleins eingelassen hat, fallen einem schnell weitere Beispiele bequemen, modischen oder falschen Sprachgebrauchs ein. Ich denke da etwa an das hochgestochene in Folge anstelle des einfachen hinter- oder nacheinander: »Der dritte Sieg in Folge«. Dahinter steckt vermutlich französisch en suite aus dem Theaterjargon. Störend ist auch der falsche Gebrauch der Pronominalform deren anstelle von derer: »Die Mittel, deren er sich dabei bediente«, oder von Quantensprung (ein Beleg dafür, dass bei uns im Physikunterricht nicht erst seit der Pisa-Studie nicht aufgepasst wird). Ich bin außerdem über die Überschrift des Vorworts gestolpert: »Ein paar Worte vorweg«; einige statt ein paar hätte mir besser gefallen. Aber darüber kann und soll man ruhig streiten, Hauptsache, man macht sich Gedanken darüber und plappert nicht alles nach, was man hört oder liest. Auf jeden Fall kann man bei gutem Willen sehr viel aus den Glossen lernen.
Wilfried Seibicke, Heidelberg