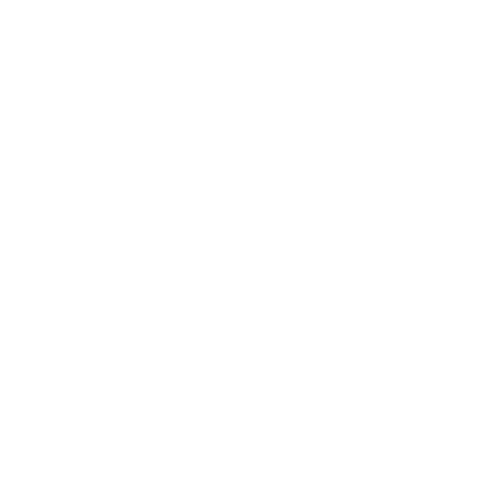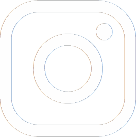Mai 2022
Was darf man heute eigentlich noch sagen? – Chancen und Risiken politisch korrekter und inklusiver Sprache
Öffentlichkeitsarbeit im Gesprächsformat

Zweig Dresden. Gut informiert und ausgerüstet mit Argumenten zum Pro und Kontra zu Gendern und Political Correctness verschiedener Beiträge in Der Sprachdienst sowie in weiteren analogen/ digitalen Angeboten wollten wir gemeinsam mit Dr. Lutz Kuntzsch ein Veranstaltungsformat in der Öffentlichkeit ausprobieren, das ein brisantes hochaktuelles Thema im Bildungsbereich aufgreift. Wir formulierten es nach Anregungen von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften des Gymnasiums Dresden-Plauen so: »Was darf man heute eigentlich noch sagen? – Chancen und Risiken politisch korrekter und inklusiver Sprache.«
Ziel unserer Bemühungen sollte sein, individuelle Befindlichkeiten zu erkunden, Hintergründe zum Für und Wider zu erfahren und Antworten auf die gestellte Frage kennen zu lernen. Den atmosphärischen Rahmen für eine lockere Gesprächssituation bildete der Festsaal des altehrwürdigen, gerade sanierten und erweiterten Jugendstilbaus des Gymnasiums, ein Ort, der Technik und Raum für die interaktive Kommunikation zwischen den Beteiligten und den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern bot.

Dr. Bertram Kazmirowski, Gymnasiallehrer für Deutsch und Englisch am Gymnasium Dresden-Plauen und langjähriges GfdS-Mitglied, hatte die Vorbereitung, Organisation und Anmoderation übernommen, was sich als eine überaus glückliche Entscheidung erwies, denn dadurch war von Anbeginn eine anspruchsvolle Gesprächsführung vorgegeben, die sich erfreulicherweise als konstruktive Gesprächsbasis erwies.
Beginnend mit dem Einspielen eines Videos von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums, das Meinungen von Vorübergehenden zum Thema präsentierte, die kontrovers waren und die Anwesenden zu Stellungnahmen animierten, schlossen sich alsbald diverse Meinungsäußerungen an, die generationsbezogene Erfahrungen einbrachten, persönliche Begegnungen mit Schlüsselfiguren der Genderbewegung bzw. deren Opponentinnen und Opponenten schilderten oder selbst Stellung dazu nahmen, wie man im eigenen Tätigkeitsbereich agierte.
Die nachfolgenden Statements haben ein differenziertes und interessantes Meinungsbild ergeben, das Diversität im Kontinuum der Generationen erkennen lässt und deutliche Rückbindungen zum individuellen Bildungs- und Erfahrungshintergrund aufweist.

Prof. Dr. Dagmar Blei blickte zum Beispiel auf ihre sprachliche Prägung zurück und stellte für sich fest:
»Im Osten sozialisiert, habe ich im Laufe meines Lebens sowie in meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit als Deutschlehrerin nie darüber nachgedacht, welch streitbares Potenzial im generischen Maskulinum schlummert. Über Jahrzehnte lehrte ich im In- und Ausland, welche Veränderungen an der deutschen Sprache der Gegenwart aufgrund gesellschaftlicher und anderer Bedingungen zu beobachten, zu erklären und in den Gesamtprozess sprachkommunikativer Tätigkeiten einzuordnen sind. Da es im Laufe der deutschen Sprachgeschichte schon mehrmals Versuche der Revision des Bestehenden, des Weglassens und Hinzufügens ›neuer‹ Sprachmittel/-strukturen auf den verschiedenen Ebenen des Sprachsystems gegeben hat, betrachte ich zwar die Bemühungen der Gender-Vertreterinnen und -Vertreter mit Interesse, aber gleichsam auch mit der Überzeugung, dass die Träger einer Sprachgemeinschaft auf lange Sicht nur das akzeptieren werden, was verständlich, sprech-, schreib-, les- bzw. hörbar sowie regelkonform ist!«
Aus diesen Worten ließ sich unschwer erkennen, wie sprachhistorische Einsichten mit Anerkennungs- und Gewohnheitseffekten bzw. Traditionsbewusstheit korrelieren und welche Pflichten Sprachvermittlerinnen und -vermittlern auferlegt werden, wenn sie berufsbedingt den usuellen Normen verpflichtet waren, aber dennoch eine gewisse Gelassenheit an den Tag legten.
Vertreter der jüngeren Generation, beispielsweise Dr. Bertram Kazmirowski, thematisierten ihr ambivalentes Verhältnis zum Gendern aus dem Wechselverhältnis zwischen normadäquater Vorbildfunktion als Lehrender der deutschen Sprache und gleichzeitiger Anerkennung aktueller Bestrebungen des inklusiven Sprachgebrauchs, aber sie offenbarten anschaulich das Dilemma zwischen »Normdisziplin« und gefühltem Veränderungsdruck im (Schul-)Alltag:
»Wie ich als Lehrer an einem Gymnasium mit der deutschen Sprache umgehe oder auch nicht umgehe – das geht leider nicht nur mich an, sondern vor allem auch meine Schülerinnen und Schüler. Denn als Deutschlehrer bin ich ein sprachliches Vorbild. Ob ich als solches von den Jugendlichen auch bewusst wahrgenommen werde, ob ich mich dieser Rolle stets würdig erweise, steht auf einem anderen Blatt, aber ich kann mich schlecht aus der Verantwortung stehlen, im Unterricht meinen Beitrag zum gepflegten und reflektierten Sprachgebrauch zu leisten. Allerdings stoße ich da an meine Grenzen. Denn manchmal scheint es mir, als habe ich nur die Wahl zwischen zwei sich ausschließenden Positionen. Entweder vertrete ich eine mir intuitiv näher liegende, konservative Position, deren Glaubenssatz darin besteht, dass Sprachwandel ein sich langsam vollziehender, aus der Sprachgesellschaft heraus organisch entfaltender Prozess ist, der keiner Lenkung bedarf. Wenn ich aus dieser Position heraus agiere, dann rede ich in einer gemischten Klasse alle Anwesenden sorglos mit ›Schüler‹ an und gehe davon aus, dass sich alle angesprochen fühlen. Oder aber ich fühle mich zur wachsenden Gruppe progressiv-offensiv auftretender Sprachkritiker/- innen hingezogen, deren Glaubenssatz darin besteht, dass Sprache nicht nur Realität abbildet, sondern diese auch verändern kann, weshalb man alle gesamtgesellschaftlichen Bemühungen um Gleichberechtigung auch in der Sprachverwendung sichtbar machen sollte. Bloß gut, dass ich bei der Diskussion als Moderator auftreten konnte und mich damit nicht öffentlich zu positionieren brauchte. Es wäre mir schwergefallen.«

Dr. Dorothea Spaniel-Weise war eigens aus Jena angereist, um einerseits unser neues »Format der Öffentlichkeitsarbeit « als Vorsitzende des Jenaer GfdS-Zweiges mitzuerleben und auch mitzugestalten. Ihr eindeutiges Bekenntnis zur Auseinandersetzung mit Sprachveränderungen als Spiegelbild gesellschaftlicher Anforderungen stützte sich auf lehrpraktische Erfahrungen mit ausländischen DaF-Studierenden. Aufgrund ihrer eigenen Vielsprachigkeit und mit dem Wissen über die Handhabung des Genderns in anderen Sprachen plädierte sie in ihrem Statement für mehr Verständnis, Respekt und Toleranz gegenüber den Kommunikationspartnerinnen und -partnern:
»Ich selbst bin von der Fähigkeit der deutschen Sprache beeindruckt, gesellschaftliche Veränderungen aufzunehmen, und begrüße die kreative Verwendung von Derivaten wie dem Ausweisen weiblicher Personenbezeichnungen. Der Einblick in ähnliche Tendenzen in anderen Sprachen wie dem Englischen, Französischen oder Spanischen war für mich Beweis dafür, dass es sich nicht um eine ›sprachliche Verirrung einer Minderheit‹, sondern das Bedürfnis nach Ausdrucksmöglichkeiten vieler Menschen handelt. Hierbei ist zentral, dass es sich nicht um Vorgaben handelt, die Sprache so oder so zu verwenden. Ich kann als Sprachnutzerin die verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten zur Kenntnis nehmen, ihren Gebrauch beobachten und die für mich sinnhaften Formen nutzen. Gerade im Kontakt mit internationalen Studierenden und Kolleg(inn)en erleichtert es mir die Adressierung enorm, wenn ich, z. B. durch die Angabe der Personalpronomen in der Signatur, angezeigt bekomme, wie mein Gegenüber angesprochen werden möchte, da mir dies allein aus dem Namen der Personen oft nicht möglich ist.«
Fast wie eine Zusammenfassung des Gesprächsabends las sich das Statement von Dr. Lutz Kuntzsch, der aktiv und inspirierend mehrmals an der Diskussion beteiligt war. Auch er bestätigte die Relevanz des Themas, präsentierte Beispiele, nannte Bewertungs- und Auswahlkriterien für die Beurteilung adäquater sprachlicher Äußerungen und förderte damit nicht nur die Entscheidungssicherheit, sondern auch die Sensibilität der Sprachtätigen im respektvollen Umgang miteinander in seinem Resümee und brachte das Grundproblem auf den Punkt.

»Die Frage ›Was darf man heute noch sagen?‹ ist keinesfalls ein marginales, sondern ein zentrales und unumgängliches Thema in der aktuellen Diskussion um eine angemessene Ausdrucksweise in allen Bereichen des Alltags. Als Grundthese wird postuliert: Eine politisch korrekte, inklusive und nichtdiskriminierende Sprache stellt heutzutage eine unabdingbare gesellschaftliche Forderung dar. Darüber herrscht Konsens, aber wie ist diese bei konkreten Einzelbeispielen und in einzelnen Situationen einzuschätzen und wie sind konkrete sprachliche Formen zu bewerten?
Mit meinen Erfahrungen aus vielen Jahren Lehre an Hochschulen und in der Sprachberatung der GfdS kann das an folgenden Beispielen aus der Praxis angedeutet und als Grundlage für eine Diskussion genutzt werden: ethnische Herkunft (Mohr und Indianer in allen Situationen nicht verwenden?), Geschlecht/Gender/sexuelle Neigung: Schwule (Umbewertung, aber nur positiv?), Zuschauer*innen (normgerecht?), bestimmte Berufsgruppe/soziale Schicht: Knöllchentante (abwertend oder ironisch?), Streeti (Bewertung? – wie im Folgenden); körperliche oder geistige Behinderung (Dummi) und religiöse Zugehörigkeit (Verschleierte).
Zusammenfassend kann gesagt werden: Es darf nur das verwendet werden, was historisch oder kontextuell begründet ist und womit man den Personen in der Kommunikation nicht beleidigend, sondern respektvoll gegenübertritt.«
Ergänzend dazu war die übereinstimmende Meinung der Veranstaltenden und auch der Teilnehmenden am Gesprächsforum, dass sich bei allen Meinungsverschiedenheiten zum angemessenen Gebrauch politisch korrekter und inklusiver Sprache das Gesprächsformat als ein sehr geeigneter Rahmen erwiesen – mit unterschiedlichen Generationen eines gemeinsamen Erfahrungskontextes an einem attraktiven Ort und mit souveräner Gesprächsführung. Er ermöglichte das Ausbalancieren des streitbaren Themenpotenzials ebenso wie die Akzeptanz, Toleranz und Diversität individueller Erfahrungen und Meinungen.
Die Mitglieder des Zweiges Dresden