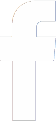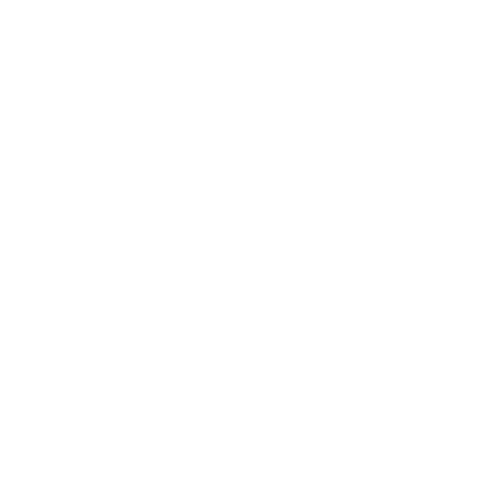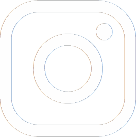»Wort des Jahres«: Die häufigsten Fragen

1. Was hat es mit dem »Wort des Jahres« auf sich?
Das »Wort des Jahres« ist eine Aktion der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) mit mittlerweile langer Tradition. Regelmäßig kürt die GfdS Wörter und Mehrwortausdrücke, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Auf Basis einer Sammlung von mehreren tausend Belegen aus verschiedenen Medien und Einsendungen von Außenstehenden, aus denen sich schließlich die sogenannte Ewigkeitsdatei der GfdS speist, wählt eine Jury kurz vor Jahresende zehn Wörter, die die öffentliche Diskussion des jeweiligen Jahres dominiert und es damit wesentlich geprägt haben. Am Ende kommt eine Liste heraus mit dem Wort des Jahres auf Platz 1 sowie weiteren Wörtern des Jahres auf den Plätzen 2 bis 10. Auf Grundlage der Zehnerliste veröffentlicht die GfdS stets zu Beginn des neuen Jahres einen sprachlichen Jahresrückblick in ihrer Zeitschrift Der Sprachdienst. In diesem Aufsatz werden neben den gewählten Wörtern des Jahres weitere prägnante Wörter aus deren sprachlichen und thematischen Umfeld betrachtet.
2. Warum ist die Aktion »Wort des Jahres« wichtig?
Die Aktion »Wort des Jahres« ist gesellschaftlich so relevant, weil die Wörter des Jahres die Zeitgeschichte Deutschlands widerspiegeln. So kann man sich die Wörter als Zeitkapseln vorstellen, also als Behälter, die zeitgeschichtlich bedeutsame bzw. aufschlussreiche Informationen enthalten und für spätere Generationen bestimmt sind. Die Idee ist, gedanklich zum Beispiel 20 Jahre zurückzugehen und sich beim bloßen Lesen der Wörter zu erinnern: an politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ereignisse. Hiermit sind womöglich Emotionen verknüpft oder sie sind bereits in Vergessenheit geraten. Vielleicht werden Sie aber auch einfach auf die Geschichte hinter den Wörtern aufmerksam und können diese nachlesen.
3. Seit wann gibt es die Aktion »Wort des Jahres«?
Die Aktion »Wort des Jahres« hat mittlerweile eine lange Tradition von über 50 Jahren: Das erste Jahreswort wurde 1971 bestimmt. Regelmäßig kürt die GfdS die Wörter des Jahres seit 1977.
4. Wie ist die Aktion »Wort des Jahres« entstanden?
Für die Entstehungsgeschichte der Aktion »Wort des Jahres« maßgeblich sind folgende Stationen:
- Die Aktion hat Ihren Ursprung in der sogenannten Ewigkeitsdatei. Das ist ein immer umfangreicher werdendes Archiv der GfdS, in dem sie nach den Kriterien der Popularität, Aktualität und Häufigkeit seit 1970 bemerkenswerte Wortbelege aus Medien und aktuellem Sprachgebrauch sammelt – zunächst noch analog in Form einer Ewigkeitskartei. Auf dieser Grundlage stellte die GfdS für das Jahr 1970 eine große Popularität des Wortes aufmüpfig fest.
- Im Folgejahr 1971 wurde aufmüpfig offiziell zum ersten Wort des Jahres erklärt. Dieses wurde 1972 in der GfdS-Zeitschrift Der Sprachdienst in einer kurzen Kolumne des Anglisten Broder Carstensen mit dem Titel »Die Wörter des Jahres 1971« veröffentlicht – der allererste Jahresrückblick.
- Erst fünf Jahre später, 1977, führte Carstensen auf Initiative des Sprachdienst-Redakteurs Helmut Walther die Wahl der Wörter des Jahres fort. In diesem Jahr wurde Szene das nächste Wort des Jahres. Fortan sollte die Wahl der Wörter des Jahres kontinuierlich und systematisch erfolgen: auf Basis der kontinuierlichen Pflege der Ewigkeitskartei. Noch bis 1980 war Carstensen Autor der entsprechenden Kolumne.
- 1981 übernahmen die GfdS-Mitarbeiter Gerhard Müller und Helmut Walther die Auswahl der Wörter des Jahres zunächst unter dem Titel »Momentaufnahmen. Beobachtungen im sprachlichen Geschehen«, später dann weitere Autoren(-Teams), welche dem jeweiligen Beitrag ebenfalls die Überschrift »Momentaufnahmen« gaben. In diesen Jahren wurden Ellenbogengesellschaft (1982), heißer Herbst (1983), Umweltauto (1984) und Glykol (1985) zum jeweiligen Wort des Jahres gekürt.
- Ab 1986 wählte man den Titel »Deutsch [Jahreszahl]«. Unter diesem Schlagwort standen etwa Tschernobyl (1986), Reisefreiheit (1989) und Besserwessi (1991).
- 1992 kehrte die GfdS mit Zustimmung der Carstensen-Erben einige Jahre nach dem Tod des Wort-des-Jahres-Initiators zum Titel »Wort des Jahres« zurück. Seither wird jährlich aus einer Sammlung von mehreren tausend Wortvorschlägen unter diesem Schlagwort der Jahressieger gekürt.
- Erst seit 2002 gibt es eine beständige Zehnerliste. Bis 2001 variierte der Umfang der Liste zwischen 4 und 12 Wörtern bzw. Ausdrücken.
5. Welche Kriterien sollten die Wörter des Jahres erfüllen?
Die Wörter des Jahres sollten folgende Kriterien erfüllen:
- Signifikanz: Die Wörter des Jahres sollten den »sprachlichen Nerv« der Zeit treffen, das heißt, sie sollten das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Geschehen des Jahres sprachlich geprägt haben.
- Sprachliche Prägnanz: Die Wörter des Jahres sollten aus sprachwissenschaftlicher Sicht interessant sein, das heißt, es sollte sich entweder um Neuschöpfungen handeln oder um bereits existierende Wörter, die eine Bedeutungserweiterung, -verschiebung oder -veränderung erfahren haben. Sprachlich prägnant kann aber auch bedeuten, dass ein Wort einfach besonders häufig zu lesen/hören war und gegebenenfalls bereits Reihen gebildet hat. (Unter Reihenbildung versteht man das wiederholte Vorkommen des Wortes in Wortbildungskonstruktionen, zum Beispiel Corona in Corona-Pandemie, Corona-Virus, Corona-Symptome, Corona-Zahlen etc.)
- Häufigkeit: Die Wörter des Jahres können, aber müssen nicht notwendigerweise die am häufigsten verwendeten Wörter und Ausdrücke eines zurückliegenden Jahres sein. Die Häufigkeit ist also nicht – wie oftmals angenommen – das ausschlaggebende Kriterium!
- Relative Neuheit: Die Wörter des Jahres sollten mehr oder weniger bekannt sein. Obwohl bei der Wahl weniger auf die Quantität als auf die Qualität eines Wortes Wert gelegt wird, sollten es in den Medien und in der Sprachgemeinschaft aufgegriffen und weiterverwendet worden sein.
Übrigens: Was das Wort auf Platz 10 angeht, kann das erstgenannte Kriterium in den Hintergrund treten. So sind wir jedes Jahr bemüht, auf Platz 10 ein Wort zu wählen, das sprachlich prägnant ist und/oder eine positive bzw. heitere Assoziation eröffnet. In der Corona-Pandemie standen auf Platz 10 zum Beispiel die Wendung Bleiben Sie gesund! und die Zusammensetzung Waschlappentipps.
6. Von einigen Wörtern des Jahres hatte ich zuvor noch nie was gehört. Wie
kann das sein?
In der Tat sind unter den Gewinnern auffällig oft Wörter, die man bis zu dem entsprechenden Jahr nie gehört hat. Das liegt zumeist daran, dass es sich bei diesen Wörtern um Neologismen (Wortneuschöpfungen) handelt. Neologismen sind einer der Gründe, warum unser Wortschatz sich ständig vergrößert. Ein Neologismus ist entweder eine Neubildung oder eine Neuprägung (auch: Neubedeutung).
Ein gutes Beispiel für das vermehrte Auftreten von Neubildungen war die Corona-Pandemie: Eine Neubildung war hier zum Beispiel das Wort freitesten (Platz 8 im Jahr 2021), das mittlerweile mit der Bedeutung ›durch ein negatives Testergebnis das Ende einer Infektionskrankheit nachweisen‹ im Duden steht. Neubildungen sind häufig Zusammensetzungen (Komposita) aus bereits bekannten bzw. lexikalisierten Wörtern (so auch freitesten aus frei und testen), denn tatsächlich ist die Komposition eine Eigenart des Deutschen bzw. eines der produktivsten Verfahren der deutschen Wortbildung. Aus diesem Grund dominieren in unseren Listen meist Komposita.
Eine Neuprägung ist zum Beispiel das Wort des Jahres 2021 Wellenbrecher: Zu dessen ursprünglicher Bedeutung ›dem Uferschutz dienende Anlage (Damm o. Ä.), die anlaufende Wellen brechen soll‹ kam die neue Bedeutung ›alle Maßnahmen, die getroffen wurden und werden, um die 4. Corona-Welle zu brechen‹ hinzu.
Ferner finden sich in unseren Verzeichnissen vereinzelt Fremdwörter, deren Kenntnis bisher möglicherweise fehlte. Ein Fremdwort ist ein übernommenes Wort aus einer anderen Sprache, dem man seine fremdsprachliche Herkunft deutlich anhört und ansieht. Zwei Beispiele aus der Corona-Zeit sind aus dem Englischen Lockdown (Platz 2 im Jahr 2020) und aus dem Französischen Triage (Platz 7 im Jahr 2020).
7. In den letzten Jahren haben Sie etwa generative Wende oder Oh, wie schön ist Panama in Ihre Liste gewählt – das sind doch aber keine Wörter, oder?
Bei den Beispielen handelt es sich um – jeweils feste – Mehrwortausdrücke bzw. Wendungen, die wir als Wörter im weiteren Sinne verstehen und somit ebenso als Wörter des Jahres aufgreifen. Diese Vorgehensweise lässt sich auch sprachwissenschaftlich begründen, doch das führt an dieser Stelle zu weit.
8. Sind die Wörter des Jahres mit einer Wertung verbunden?
Nein, die ausgewählten Wörter und Wendungen sind mit keinerlei Wertung oder Empfehlung verbunden. Die GfdS beobachtet, dokumentiert und analysiert den aktuellen Sprachgebrauch und positioniert sich darauf aufbauend zu sprachlichen Phänomenen. Hingegen ist es nicht unser Ziel, bewusst in die Sprachentwicklung einzugreifen, indem wir etwa den Gebrauch oder die Art des Gebrauchs eines Wortes vorschreiben. Ein solches Vorgehen wäre nicht mit unserem Selbstverständnis einer neutralen Ausrichtung vereinbar.
9. Meinem Gefühl nach sind die Wörter des Jahres immer sehr negativ. Können
Sie nicht mal etwas Positives auf Platz 1 wählen?
Ob ein Wort negativ oder positiv konnotiert ist, gehört nicht zu den Kriterien, nach denen wird die Wörter des Jahres auswählen. Diese sind Signifikanz, sprachliche Prägnanz, relative Neuheit und Häufigkeit (siehe Frage 5). So schaffen es in unsere Liste Wörter und Ausdrücke, die im zurückliegenden Jahr in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hervorgetreten sind. Anders formuliert: Unsere Listen bilden stets das ab, was uns das Weltgeschehen und die Sprachgemeinschaft, im Wesentlichen die Medien, »anbieten«.
10. Wer wählt die Wörter des Jahres?
Die Wörter des Jahres werden von einer Jury gewählt, die hauptsächlich aus Sprachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern besteht. Sie setzt sich aus dem Hauptvorstand und den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GfdS zusammen. Ferner besteht die Option, dass auch Medienexpertinnen und -experten sowie Kulturschaffende hinzutreten.
11. Wie werden die Wörter des Jahres gewählt?
Das ganze Jahr über sammeln wir Wortvorschläge für die eigentliche Wort-des-Jahres-Wahl, die immer am Ende eines Jahres, Anfang Dezember, stattfindet. Täglich werten wir bestimmte Tageszeitungen systematisch und weitere Medien punktuell aus, zum Beispiel weitere Zeitungen, Zeitschriften und Internetseiten, aber auch Medien der gesprochenen Sprache wie Fernseh- und Radiosendungen oder Podcasts (mehr Informationen siehe Frage 15). Zudem sammeln wir externe Belege, also Vorschläge von Sprachinteressierten, die per E-Mail oder auch Post bei uns eintreffen. Dies bezüglich rufen wir zumeist im ersten Jahresheft unserer Zeitschrift Der Sprachdienst im Rahmen einer Preisaufgabe dazu auf, uns Vorschläge zu schicken, und auch auf unserer Website regen wir dazu an.
Alle Belege werden in einer Gesamtdatei – wir nennen diese unsere »Ewigkeitsdatei« – mit Stichwort (das ist der Wortbeleg), kurzer Beschreibung des Verwendungskontextes sowie Quelle und Datum dokumentiert. Dabei wird jedes Stichwort einer Kategorie zugewiesen, zum Beispiel Konflikte/Kriege, Politik (Innen- und Außen-), Wirtschaft, Soziales/Gesellschaft, Ökologie, Kultur und Sprache. Die Datei enthielt in den vergangenen Jahren stets etwa 2000 Belege.
Kurz vor der Jurysitzung werden in einer Vorschlagsliste ca. 100 »Top-Kandidaten« zusammengetragen – jene Belege, die sich am besten für die Liste der Wörter des Jahres eignen könnten. In der Jurysitzung Anfang Dezember werden dann aus den Top-Kandidaten die 10 Siegerwörter gewählt.
12. Wie kann ich mir den eigentlichen Wahlvorgang bzw. den Ablauf der
Jurysitzung vorstellen?
In der vom Vorstandsvorsitzenden moderierten Jurysitzung werden die der Ewigkeitsdatei entnommenen Topkandidaten (siehe Frage 11) nach ihrer Tauglichkeit im Hinblick auf die Kriterien für die Wörter des Jahres (siehe Frage 5) besprochen und eingegrenzt, bis die 10 Wörter für die Liste feststehen. Auch auf der Vorschlagsliste bislang nicht berücksichtigte Wörter und Ausdrücke können hier diskutiert werden. Anschließend werden die Top 3 und sodann Platz 1, das Wort des Jahres, bestimmt. Die endgültige Reihenfolge der verbleibenden neun Wörter wird zuletzt festgelegt. Bei strittigen Entscheidungen wird zuweilen auch abgestimmt. Visualisiert wird die Diskussion dabei am Flipchart. Keine der zuvor getroffenen Entscheidungen ist zum jetzigen Zeitpunkt endgültig: Es ist schon manches Mal vorgekommen, dass die Liste – und auch Platz 1 – vor ihrem endgültigen Beschluss in Frage gestellt wurde.
13. Ist die Aktion »Wort des Jahres« wissenschaftlich?
Nein, der Aktion »Wort des Jahres« liegen keine strengen wissenschaftlichen Kriterien zugrunde. Gleichwohl sind die Wort-des-Jahres-Kriterien Signifikanz, sprachliche Prägnanz, relative Neuheit und Häufigkeit (siehe Frage 5) sprachwissenschaftlich relevant, und Sprachwissenschaftler(inn)en können medial präsente Wörter nach den genannten Kriterien angemessen beurteilen. Insofern folgt die Aktion dem Motto »Ernste Spiele«, eine echte statistische Auswertung im Sinne einer Korpusanalyse führt die GfdS jedoch nicht durch. (Unter einer Korpusanalyse versteht man in der Sprachwissenschaft die Auswertung einer großen Textsammlung nach definierten Kriterien.) Kurzum: Die Wörter des Jahres unterliegen rein subjektiven Kriterien, und die Jahresrückblicke, die sich ihnen widmen und die wir regelmäßig in unserer Zeitschrift Der Sprachdient veröffentlichen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
14. Wann werden die Wörter des Jahres bekannt gegeben?
Das Wort des Jahres wird seit vielen Jahren an einem Freitag Anfang Dezember um 10 Uhr in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Der Vorsitzende der GfdS verliest dazu die Pressemitteilung und erläutert die gewählten Wörter – von Platz 10 bis Platz 1.
15. Woher stammen die Belege für die Wörter des Jahres?
Die sprachwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GfdS werten das ganz Jahr über bestimmte Tageszeitungen systematisch und weitere Medien punktuell aus.
Systematisch ausgewertet werden:
- Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS)
- Wiesbadener Kurier (WK)
Punktuell werden ausgewertet:
- andere überregionale Tageszeitungen wie die Die Tageszeitung (taz), Die Zeit, Süddeutsche Zeitung (SZ) und Welt
- diverse regionale Tageszeitungen
- weitere Print-/Online-Zeitungen und -Zeitschriften, zum Beispiel Der Spiegel oder Focus
- diverse Onlinemedien, zum Beispiele Internetauftritte von Rundfunkanbietern, offiziellen Stellen, Organisationen und Vereinen
- Beiträge aus Funk und Fernsehen wie Nachrichtensendungen, Interviews und Talkshows
- Podcasts
16. Kann ich beim »Wort des Jahres« mitmachen?
Ja, das können Sie sehr gern! Wir möchten alle Sprachinteressierten dazu auffordern, sich an der Sammlung der Vorschläge für die Wörter des Jahres zu beteiligen. Wir suchen insbesondere Wörter und Ausdrücke, die im Laufe des Jahres besonders in Erscheinung treten, in neuen Bedeutungen verwendet werden oder besonders präsent sind (entsprechend unseren Kriterien, siehe Frage 5).
Übrigens: Unter allen gültigen Einsendungen verlosen wir jedes Jahr einen attraktiven Buchpreis.
17. Wie kann ich meine Vorschläge für das »Wort des Jahres« einreichen?
Sie können uns Ihre Vorschläge wie folgt zusenden:
- per Kontaktformular (unter https://gfds.de/aktionen/wort-des-jahres/#vorschlag)
- per E-Mail an wort-des-jahres@gfds.de
- per Post an Gesellschaft für deutsche Sprache, Spiegelgasse 7, 65183 Wiesbaden
Bitte füllen Sie das Kontaktformular möglichst vollständig aus und hinterlegen Sie eine nachvollziehbare Begründung für Ihren Vorschlag.
Für die Kontaktaufnahme per E-Mail oder Post gilt: Bitte begründen Sie Ihren Vorschlag genau. Zudem geben Sie bitte an: die Quelle des Belegs, das Datum des Belegs (nicht des Funds), die URL (bei Online-Belegen).
Hinweis: Wir können nur Vorschläge berücksichtigen, die eine kurze Begründung enthalten! Bitte geben Sie daher immer an, warum ihr Vorschlag aus Ihrer Sicht als Wort des Jahres besonders geeignet ist.
Einsendeschluss ist der 30. November des laufenden Jahres.
18. Was hat es mit dem »Unwort des Jahres« auf sich? Ist das nicht auch eine
Aktion der GfdS?
Die GfdS wird immer mal wieder mit dem »Unwort des Jahres« in Verbindung gebracht. Dies ist insofern nachvollziehbar, als diese Aktion 1991 vom damaligen Vorsitzenden des GfdS-Zweigs in Frankfurt am Main initiiert wurde, Horst Dieter Schlosser. Dennoch ist es verwunderlich, denn schon 1994 nahm Schlosser die Aktion in eigene Regie. Seitdem wird die Unwort-Wahl von einer unabhängigen Jury aus Sprachwissenschaftler(inne)n und Medienexpert(inn)en durchgeführt. Diese Wahl basiert ausschließlich auf dem Mitwirken der Bevölkerung: Alle Sprachinteressierten können Vorschläge einreichen. Die Jury wählt das »Unwort des Jahres« dann im Januar des Folgejahres; zugrunde liegen jedoch andere Kriterien als für die Wahl zum »Wort des Jahres«. So stehen Wörter und Ausdrücke im Fokus, die insbesondere gegen die Menschenwürde und die Prinzipien der Demokratie verstoßen.
19. Was hat es mit dem »Jugendwort« auf sich? Wählt die GfdS das auch?
Von Zeit zu Zeit wird die GfdS auch mit dem »Jugendwort« in Verbindung gebracht. Zwar hat die GfdS in Ihrer Zeitschrift Der Sprachdienst und auch auf Ihrer Website einige Beiträge zu dem Thema Jugendsprache veröffentlicht und bietet auf Ihrer Website ein Jugendsprache-Quiz an, allerdings steht die Jugendwort-Aktion seit jeher unter der Leitung des Langenscheidt-Verlags. Wie die Unwort-Wahl ist die Jugendwort-Wahl vom Mitwirken der Bevölkerung abhängig: Alle jungen Erwachsenen sowie Sprachinteressierte können in einem begrenzten Zeitfenster von etwa 1,5 Monaten im Frühjahr/Sommer Vorschläge einreichen, das Siegerwort wird immer im Herbst verkündet.
20. Gibt es in Deutschland noch weitere Aktionen dieser Art?
Seit 2025 wird in Deutschland auch ein »Wortgetüm des Jahres« gewählt – eine gemeinsame Aktion der Berliner Alpha-Bündnisse, der Stiftung Grundbildung Berlin und des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache (DWDS) der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Das Wortgetüm ist ein Wort, das Menschen mit geringen Lese- und Schreibkompetenzen im vergangenen Jahr besonders große Schwierigkeiten bereitet hat. Insofern will die Ungetüm-Aktion für eine verständliche(re) Sprache sensibilisieren. Die Vorauswahl beruht auf einem Korpus (große Textsammlung) des DWDS, die Jury besteht aus Personen der Zielgruppe.
21. Werden auch in anderen Ländern Wörter des Jahres gewählt?
Ja, auch in anderen Ländern gibt es vergleichbare Aktionen. Allerdings ist das »Wort des Jahres« der GfdS, 1971 ins Leben gerufen, die erste Aktion ihrer Art. Inzwischen hat sie weltweit Nachahmer gefunden. So gibt es rund um den Globus ähnliche Aktionen, (in alphabetischer Reihenfolge) etwa in Australien, Belgien, China, Frankreich, Großbritannien, Japan, Katalonien, Liechtenstein, den Niederlanden, Österreich, Polen, Schweden, der Schweiz, Slowenien, Tschechien, der Ukraine und den USA. Über die jeweiligen Aktionen und Siegerwörter im Ausland berichten wir auch in unserem Jahresrückblick zu den Wörtern des Jahres, den wir zumeist in der ersten Ausgabe eines Jahres unserer Zeitschrift Der Sprachdienst veröffentlichen.
22. Wo finde ich weitere Infos zur Aktion »Wort des Jahres«?
Weitere Infos zu unserer Aktion »Wort des Jahres« finden Sie hier:
- Die Wörter des Jahres der vergangenen Jahre finden Sie auf unserer Website. Hier können Sie alle Listen seit 1971 einsehen. Zu den Listen ab 2005 können Sie auch die jeweilige Pressemitteilung mit den Begründungen zu den gewählten Wörtern nachlesen.
- Die Jahresrückblicke zu unseren Wörtern des Jahres einschließlich jeweils eines Überblicks zu den Siegerwörtern vergleichbarer Auslandsaktionen finden Sie zumeist in der Erstausgabe eines Jahres unserer Zeitschrift Der Sprachdienst (Heft 1 bzw. Heft 1–2; teilweise auch Heft 2, 3, 3–4). In Heft 3–4/2021 kommen Juryverantwortliche aus dem Ausland selbst zur Sprache und berichten über ihre Aktionen. Die einzelnen Beiträge und die Gesamtausgaben sind in unserem Onlineshop erhältlich.
- Grundsätzliches zur Geschichte und Entwicklung der Aktion wurde in zwei umfassenden Publikationen aufbereitet und mit vielen grundlegenden Informationen, Zahlen und Fakten angereichert: (1) Jochen A. Bär (Hg.), Von »aufmüpfig« bis »Teuro«. Die »Wörter der Jahre« 1971–2002, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2003 (= Thema Deutsch, Band 4), und (2) Jochen A. Bär und Jana Tereick (Hgg.), Von »Szene« bis »postfaktisch«. Die »Wörter des Jahres« der Gesellschaft für deutsche Sprache 1977 bis 2016, Hildesheim/Zürich/New York 2017 (= Thema Deutsch, Band 14). Mehr Informationen zu diesen Büchern finden Sie auf unserer Website.
- Ausführliche Hintergründe zu unserer Aktion sowie Infos zu vergleichbaren Aktionen im Ausland finden Sie in unserem Online-Beitrag »Im Fokus: Die Wörter des Jahres«.
- Hintergründe und Wissenswertes zu unserer Aktion erfahren Sie auch in fünf kurzen YouTube-Videos; hier kommt unserer ehemaliger Vorsitzende Prof. Dr. Peter Schlobinski zu Wort.