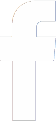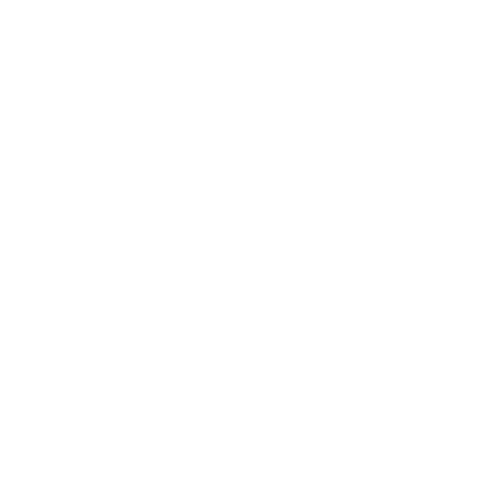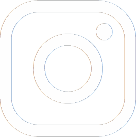25. Juni 2024
»Einer geht noch, einer geht noch rein«: Warum Fangesänge mehr sind als nur Gegröle

»Oh, wie ist das schön …«: In Fußballstadien wird traditionell gesungen – ganz egal, ob die eigene Mannschaft gerade auf der Überholspur ist oder ihre Chancen noch nicht ausgespielt hat. Fangesänge machen einfach Spaß, und das haben im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft 2024 auch die beiden Hollywood-Stars Will Smith und Martin Lawrence bewiesen. In einem humorvollen Video-Clip, der auf einschlägigen Social-Media-Kanälen zu sehen ist, bringen ihnen die Nationalelf-Spieler İlkay Gündoğan und Antonio Rüdiger Schlachtrufe bei.[1] Diese wiederum haben über den Spaßfaktor hinaus auch eine sprachliche Funktion.
»Einer geht noch, einer geht noch rein«: Hoffentlich schmettern die Fans das bei den Spielen der deutschen Mannschaft, was auch die beiden US-Schauspieler mit den Fußballern gesungen haben – und lassen damit die typisch lebhafte Atmosphäre und das Gemeinschaftsgefühl aufkommen, das den Fußball ausmacht. Klar ist: Fans singen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Sie drücken damit ihre Emotionen aus und eine Verbindung mit den Spielern. Doch positiv müssen diese Fangesänge deswegen nicht zwangsläufig sein. »Oftmals sollen sie eine Provokation gegen die gegnerische Mannschaft auslösen oder einen Machtkampf zum Ausdruck bringen […]«, betonen Farnosch Khodadadi und Anika Gründel.
Sprachwissenschaftlich betrachtet haben die Fangesänge dabei bestimmte Funktionen und lassen sich wie auch Schlüsselwörter, die in Schlachtrufen vorkommen, in verschiedene Kategorien einteilen. Georg Brunner (2009) widmet sich der Untersuchung dieser Fangesänge und wie sie kategorisiert werden können. Dabei stellt er eine interessante Gliederung von Farnosh Khodadadi und Anika Gründel (2006: 10 f.) vor, die sich am Kontext der Gesänge orientiert:
- Unterstützende Fangesänge (Anfeuerung, aber auch Kritik am Gegner: »Haut drauf, Kameraden, haut drauf, haut drauf«; »Come on, FC«)
- Solidarische Fangesänge (Empathie, Zugehörigkeit: »Wir sind die Eintracht, Eintracht ist unser Verein«)
- Fordernde Fangesänge (Erwartungsäußerung, z. B. Sieg: »Kämpfen, Dortmund, kämpfen«)
- Euphorische Fangesänge (Hoffnung und Begeisterung: »Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin«)
- Huldigende Fangesänge (oft auf einen Spieler als »Fußballgott« bezogen, z. B. rhythmisches Rufen des Namens eines Spielers)
- Ausgrenzende Fangesänge (auch gegen eigene Spieler oder den eigenen Trainer bei Misserfolg, meist aber gegen den Gegner: »Wir hassen Dortmund, wir hassen Schalke, aber ihr, ihr seid die Pest, Ostwestfalen, Idioten, Scheiß Arminia Bielefeld«)
- Diffamierende Fangesänge (Kritik am Gegner: »Duisburger Arschlöcher«)
- Irreführende Fangesänge (Ablenkung des Gegners, auch gegen Schiedsrichter: »Bayern, wir hören nichts«) (Brunner 2009: 202–203)
Khodadadi und Gründel sprechen laut Brunner zudem von Schlüsselwörtern, die immer wieder auftreten und sich ebenfalls in Kategorien einteilen lassen. Dazu zählen
- Zugehörigkeitsbekundung (z. B. Pronomina wir, unser, ihr, sie)
- Mannschaftskennzeichnungen (Vereinsfarben, Trikot, Namen der Mannschaft)
- Sport- und Sportartkennzeichnungen (z. B. Gegner, Tor, Spiel)
- Euphorische Expressionen (z. B. Traum, Herz, Schnee, Licht)
- Fäkalwörter (z. B. Scheiß)
- Negative Titulierungen (z. B. Idioten, Pest, Hurensöhne).
Fangesänge sind also nicht einfach nur Gegröle, sondern erfüllen je nach Kategorie bestimmte Funktionen und tragen damit bedeutend zur Dramaturgie eines Fußballspiels bei. Vielleicht wird Niclas Füllkrug ja mit Fangesängen gehuldigt, weil er in der Nachspielzeit gegen die Schweiz mit seinem Tor die DFB-Elf zum Gruppensieger gemacht und schon beim EM-Auftaktspiel gegen Schottland getroffen hat. So spannend das Achtelfinalspiel für die Fans der deutschen Mannschaft auch werden mag: Möglicherweise ergibt sich ja für den einen oder die andere eine Gelegenheit, einmal auf die verschiedenen Fangesänge zu achten – und sie zu kategorisieren.
Quellen
Brunner, Georg: »Fangesänge im Fußballstadion.« In: Armin Burkhardt/Peter Schlobinski (Hgg.): Flickflack, Foul und Tsukahara. Der Sport und seine Sprache. Mannheim 2009 (= Duden, Thema Deutsch, Band 10), S. 194–210.
Khodadadi, Farnosch/Gründel, Anika: Sprache und Fußball – Fangesänge. Essen 2006 (= Linguistik-Server Essen), https://de.readkong.com/page/sprache-und-fusball-fangesange-3242941 (Stand 24.04.2024).
[1] DFB-Stars bringen Will Smith deutsche Fan-Lieder bei (Stand 24.06.2024).
Alle weiteren Beiträge in dieser Reihe finden Sie in unserem Sprachraum »Sprache und Fußball«.