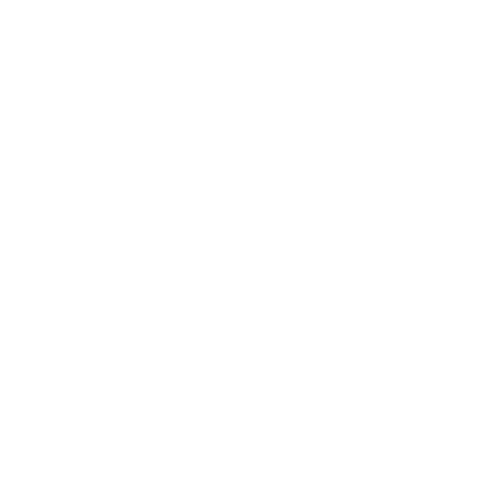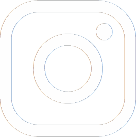Gesandte vs. Gesandtin
[F] Bei meiner Arbeit ist mir bereits des Öfteren der Begriff »die Gesandtin« aufgefallen. Ist diese Form korrekt oder müsste es nicht vielmehr heißen »die Gesandte«?
[A] Der Ausdruck Gesandte ist die korrekte Substantivierung des Partizips II von senden: gesandt. Die schwach deklinierte Form ist in allen drei Genera im Nominativ identisch (der, die, das Gesandte). Diese Identität gilt grundsätzlich für alle substantivierten Adjektive und Partizipien. Umso erstaunlicher ist es, dass der Duden neben der femininen Form die Gesandte auch die Gesandtin führt (Duden. »Die Deutsche Rechtschreibung«, 25. Aufl., Mannheim 2009).
Das Ableitungssuffix -in kann in der Regel an maskuline Personenbezeichnungen angehängt werden, um eine feminine Entsprechung zu erzeugen. Dies gilt nach den heutigen Regeln der Wortbildung allerdings nicht für substantivierte Adjektive und Partizipien. Die Form Gesandtin scheint demnach entgegen dieser heute geltenden Regeln gebildet worden zu sein. Woher kommt also diese Form, die weder mit den Wortbildungsregeln vereinbar zu sein scheint noch notwendig ist, da ja die Form Gesandte beide Geschlechter bezeichnen kann?
Die Substantivierung Gesandte entstand aus dem frühneuhochdeutschen Ausdruck gesanter pote und ist laut Pfeifers »Etymologischem Wörterbuch« von 1989 seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich. Die weibliche Ableitung mit dem Suffix –in wurde wahrscheinlich nicht viel später gebildet.
Die Zeit der Renaissance und des Barock ist die Zeit, in der das Suffix –in enorm produktiv war. In dieser Zeit wurden zahlreiche substantivierte Adjektive und Partizipien mit der Nachsilbe –in bzw. –inn gebildet. So finden wir z. B. in der 1663 erschienenen Grammatik »Ausführliche Arbeit von der teutschen Haubtsprache« von Justus Georg Schottel die Wörter die Beklagtinn oder die Teutschinn. Beide Wörter sind heute nicht mehr gebräuchlich, stattdessen verwenden wir der/die Beklagte und der/die Deutsche. Weitere Beispiele führt Johann Bödiker in seiner Grammatik »Grundsätze der Teutschen Sprache« von 1690 an, so z. B. die Gläubiginn, die Heiliginn oder die Gutinn. Auch diese Ausdrücke werden heute nicht mehr als korrekt angesehen, sondern wiederum verwendet man nur noch die für beide Geschlechter identischen Formen der/die Gläubige, der/die Heilige und der/die Gute.
Diesen für unser heutiges Sprachgefühl befremdlichen Ableitungen war allerdings keine lange Karriere beschieden. Bereits nach etwas mehr als fünfzig Jahren schreibt Johann Jacob Wippel in der von ihm bearbeiteten Neuauflage der Bödiker’schen Grammatik, dass bei substantivierten Adjektiven und Partizipien die Motion, also die Bildung weiblicher Personenbezeichnungen aus den männlichen mit dem Suffix –in bzw. –inn, nicht mehr gebräuchlich sei.
Auch in Adelungs großem Wörterbuch des 18. Jahrhunderts sind all diese Beispiele nicht mehr verzeichnet. Nur der Ausdruck die Gesandtin findet sich noch bei Adelung. Dazu heißt es in der zweiten Auflage von 1793 ff.: »Die Gemahlinn eines Gesandten heißt die Gesandtinn, eine solche gesandte Person weiblichen Geschlechtes aber würde eine Gesandte heißen müsse [sic!].« (Johann Christoph Adelung: »Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen, zweyte, vermehrte und verbesserte Ausgabe«, Leipzig 1793–1801) Hierin wird zweierlei deutlich: Zum einen weist Adelung darauf hin, dass die korrekte Benennung für eine gesandte Person unabhängig vom Geschlecht Gesandte lauten müsste. Zum anderen bezieht er den Ausdruck die Gesandtinn lediglich auf die Ehegattin eines Gesandten.
Letzteres ist ein typisches Phänomen jener Zeiten. Das Genus von Berufsbezeichnungen stimmte damals weitgehend mit dem natürlichen Geschlecht derjenigen Personen überein, die den Beruf in der Regel ausübten. Durch die Ableitungsform mit dem Suffix –in wurde dementsprechend nicht eine Frau bezeichnet, die den gleichen Beruf ausübt wie ein Mann, sondern die Ehefrau eines Mannes, der eine bestimmte Berufsbezeichnung trägt.
Die hohe Produktivität der Nachsilbe –in im 16. und 17. Jahrhundert erklärt sich insbesondere aus dem Bestreben, eine möglichst klare Trennung zwischen männlichen und weiblichen Bereichen herzustellen. War man auf gesellschaftlicher Ebene bemüht, Männern und Frauen disjunkte Rollen zuzuweisen und Frauen den Zugang zu typisch männlichen Berufen zu verweigern, so waren die normativen Grammatiken jener Zeit bestrebt, diese Trennung auch auf einer sprachlichen Ebene zum Ausdruck zu bringen.
Ein generisches Maskulinum, mit dem beide Geschlechter bezeichnet werden sollen, kannten die sprachwissenschaftlichen Werke jener Zeit nicht. Erst spätere deskriptive Grammatiken beschreiben dieses Phänomen, das heute ebenso wie damals abgelehnt wird, freilich aus anderen Gründen. Während heute das generische Maskulinum zu Recht kritisiert wird, weil damit das weibliche Geschlecht nur »mitgemeint« ist, hätte man es damals abgelehnt, um nicht in die »Gefahr« zu geraten, dass mit einem maskulinen Wort auch eine Frau gemeint sein könnte, und damit die klare Trennung des Männlichen und Weiblichen infrage zu stellen.
Um auf den Begriff der Gesandtin zurückzukommen, so ist dieser heute einer der wenigen noch gebräuchlichen Ausdrücke, die aus einem substantivierten Partizip und dem Movierungssuffix –in zusammengesetzt sind, während beinahe alle anderen Beispiele ausgestorben sind. Heute wird mit diesem Begriff freilich nicht mehr die Ehegattin eines Gesandten bezeichnet, sondern ausschließlich Frauen, die den Beruf einer Gesandten ausüben. Warum gerade dieser Begriff überlebt und sich durchgesetzt hat, bleibt ein sprachgeschichtliches Phänomen.