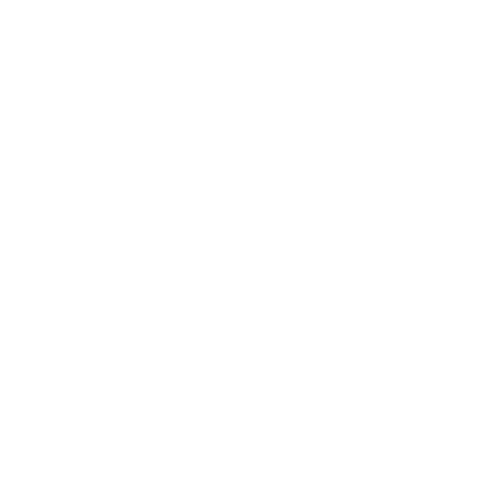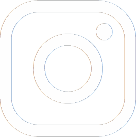Sprache und Geschlecht. Beiträge zur Gender-Debatte
Zur Einführung in das Themenheft
Von Andrea-Eva Ewels und Albrecht Plewnia
Wohl kaum ein sprachliches Problem wird gegenwärtig mit derart viel Leidenschaft diskutiert wie die Frage, wie am angemessensten mit der Tatsache umzugehen sei, dass biologisches Geschlecht auf der einen Seite und grammatisches Genus auf der anderen Seite zwar prinzipiell verschiedene Kategorien darstellen, zugleich allerdings in bestimmter Weise aufeinander beziehbar sind. Natürlich sind Substantive nicht »männlich« oder »weiblich« oder »sächlich«, und die mit den Substantiven bezeichneten Dinge sind es auch nicht, aber Menschen (und Tiere) haben ein Geschlecht, und wir nutzen das Genus (unter anderem), um sprachlich auf das Geschlecht zu referieren.
Die Welt ist komplex, und die Frage, ob der übliche Sprachgebrauch diese Komplexität in adäquater Weise abbildet, ist keineswegs trivial. Das betrifft schon länger die Nichtsichtbarkeit von Frauen an der sprachlichen Oberfläche bestimmter grammatischer Formen, es betrifft neuerdings auch die Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Form weitere minoritäre Geschlechter eine sprachliche Repräsentanz finden sollen. Sprache hat immer auch mit Identität zu tun; Identitätsfragen aber beinalten stets eine subjektive Komponente und sind daher nur eingeschränkt verhandelbar. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass die in der (medialen) Öffentlichkeit geführte Debatte, in Feuilletons und Leserbriefen, erstens kontrovers und zweitens nicht frei von gewissen Verkürzungen und argumentativen Unschärfen ist. Mit dem vorliegenden Themenheft wollen wir zu dieser Debatte einige Differenzierungen und Präzisierungen aus der Sicht der Sprachwissenschaft (als der genuin zuständigen Disziplin) beitragen, die zeigen, dass es eben keine einfachen Antworten gibt und dass es sich auch bei diesem Thema lohnt, genauer hinzusehen.
Den Aufschlag macht Peter Eisenberg mit einigen grundsätzlichen Überlegungen über »[d]ie Vermeidung sprachlicher Diskriminierung im Deutschen«. Zentraler Gegenstand der Auseinandersetzung um geschlechtergerechtes oder gendergerechtes Sprechen (was nicht notwendig dasselbe ist) ist das sogenannte generische Maskulinum. Nach einer kurzen Einordnung des aktuellen Diskurses in die Geschichte der feministischen Linguistik diskutiert er aus einer synchronen Perspektive, ausgehend von den mit -er-Suffix gebildeten Substantiven (die typischerweise ein Agens bezeichnen), die spezifische Leistung des generischen Maskulinums im grammatischen System und betont dessen Funktion als unmarkierte Form.
Doch natürlich hat auch das System seine Geschichte. Damaris Nübling zeigt in ihrem Beitrag »Was Genus, Deklination und Binomiale uns über Geschlechter(un)ordnungen berichten«, dass sich hinter so vermeintlich neutralen grammatischen Kategorien wie etwa derjenigen der Deklinationsklassen der Substantive durchaus Reflexe sozialer Kategorisierungen verbergen (die den Sprecherinnen und Sprechern nur selten bewusst sein dürften). So gibt es offenbar auch sehr klare Regeln in der Genus-Sexus-Zuordnung von Personenbezeichnungen, die die (historischen) Geschlechterverhältnisse spiegeln; zugleich lässt sich aber bei der Verwendung von Paarformeln, wo in den meisten Fällen die männlichen Referenten zuerst genannt werden (Typ: »Jungen und Mädchen«), in bestimmten Fällen eine gewisse Dynamik nachweisen (neuerdings häufiger: »Mädchen und Jungen«).
Die grammatischen Strukturen sind das eine, die textuellen Bilder, die sich im Gebrauch zu Stereotypen verdichten, das andere. Sina Lautenschläger zeichnet in ihrem Beitrag »Von Rabenmüttern und geldverdienenden Supermännern – Stereotype im Sprachgebrauch« anhand eines Korpus von Pressetexten nach, wie sich in den letzten Jahrzehnten das Sprechen über Geschlechter entwickelt hat. Dabei zeigt sich, dass es sehr stabile semantische Prägungen gibt, zugleich aber auch, dass diese einer kritischen Reflexion zugänglich sind.
Praktisch alle großen Textkorpora basieren auf Texten professioneller, insoweit privilegierter Schreiber. Astrid Adler und Karolina Hansen berichten hingegen in ihrem Beitrag »Studenten, Student/-innen, Studierende? Aktuelle Verwendungspräferenzen bei Personenbezeichnungen« über eine aktuelle Repräsentativumfrage des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache, in der linguistische Laien zu ihren Präferenzen beim sprachlichen Gendern befragt wurden. Zumindest für die Lexemgruppe Student usw. erwies sich die Partizipialform Studierende als die mehrheitlich akzeptierte Leitform.
Unmittelbare praktische Konsequenzen hat die Frage eines geschlechtergerechten oder geschlechterinklusiven Sprachgebrauchs dort, wo es um die Orthografie geht, die ja amtlich geregelt ist. In ihrem Beitrag »Zwischen gesellschaftlichem Diskurs und Rechtschreibnormierung: Geschlechtergerechte Schreibung als Herausforderung für gelungene Textrealisation« zeigt Sabine Krome, wie der Rat für deutsche Rechtschreibung in diesem Zusammenhang seiner Aufgabe der Schreibbeobachtung nachkommt.
Das hier diskutierte Problem ist kein spezifisch deutsches Problem; der Diskurs um Genus, Sexus und Gender ordnet sich ein in einen gegenwärtig in der gesamten westlichen Welt geführten Diskurs um Identität, Teilhabe und Gerechtigkeit. Allerdings steht das Deutsche als Sprache, die über drei Genera, ein Kasussystem und eine relativ ausgebaute Flexion, auch im Pronominalbereich, verfügt, hier vor besonderen Herausforderungen. In unserem Forum fragen wir, wie in einigen unserer europäischen Nachbarländern mit dem Problem umgegangen wird. Das Schwedische hat es hier, wie Steffen Höder zeigt, vergleichsweise leicht; hier hat sich in jüngster Zeit in einigen Bereichen sogar ein neues Sexus-neutrales Pronomen durchsetzen können. Ähnlich unkompliziert ist, wie Matthias Hüning berichtet, die Situation im Niederländischen, das über ein Zweikasus-System verfügt und wo das generische Maskulinum in einer Sexus-indifferenten Lesart dominiert. Das Polnische hingegen hat ein ausgesprochenen differenziertes Genussystem und eine reiche Flexion, wobei, wie Marek Łaziński und Waldemar Czachur demonstrieren, insbesondere der Zwang zur konsequenten Genusmarkierung auch an kongruierenden Wörtern eine sprachliche Gleichstellung extrem schwer macht. Vincent Balnat schließlich berichtet aus Frankreich, wo sich insbesondere in akademischen Kontexten eine Form des geschlechterinklusiven Schreibens etabliert hat, die allerdings in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird.
Wiesbaden und Mannheim, im März 2020