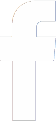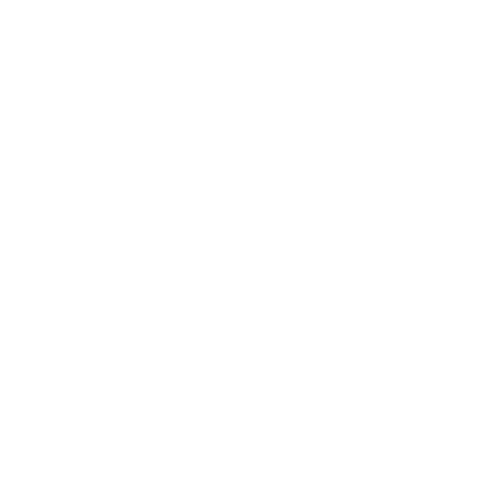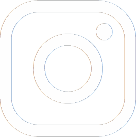Trans, inter und cis
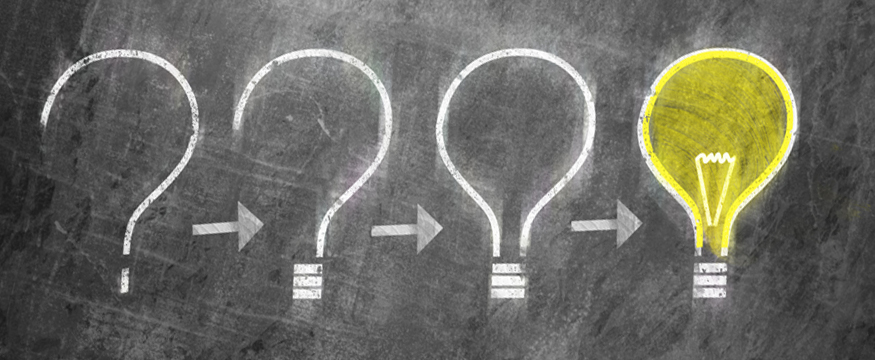
In der Orthografie zeigt sich ein Phänomen, das die geschlechtliche Diversität spiegelt: Der Genderstern (oder ähnliche Sonderzeichen) ist ein in der deutschen Rechtschreibung innerhalb eines Wortes unzulässiges Zeichen, das insbesondere von der betroffenen Community begrüßt wird, da es die Abweichung von bzw. Vielfalt fernab binärer Strukturen auch sprachlich sichtbar macht. Dass diese Abweichung kein Einzelfall ist, zeigt ein Blick auf (vor allem Selbst-)Zuschreibungen. Betroffene Menschen bezeichnen sich als trans oder inter und die mit dem natürlichen Geschlecht in Einklang lebenden Personen als cis (meist cisgender, auch zis-). Es handelt sich bei all diesen Adjektiven um indeklinable, also stets unflektierte Formen. Prädikativ gebraucht ist das korrekt – in dieser Funktion werden Adjektive nicht dekliniert (Mette ist trans) –, in attributiver Funktion stellt dies nach geltender Norm allerdings einen Verstoß dar, so wie der viel diskutierte Genderstern.
Genauer betrachtet handelt es sich bei allen drei Wörtern um Kurzformen: trans zu transgeschlechtlich, inter zu intersexuell und cis zu cisgender.[1] Hierbei gibt es aber Unterschiede: Während transgender nicht dekliniert werden kann, kann dies transsexuell sehr wohl, da sexuell ein Adjektiv ist (Gender ein Substantiv). Doch warum können die Kurzformen eigentlich nicht flektiert werden? Die Antwort ist einfach: Es handelt sich um keine selbstständigen Wörter, sondern um (gebundene) Wortbildungsmittel (Affixoide), die aus der Wortbildung (der »Vollform« wie transsexuell) wieder herausgelöst worden sind. Generell ist dies selten, kommt aber auch bei Komposita vor (Korn zu Kornbrandwein).
Auch hetero-/homosexuell werden übrigens mit ihren Kurzformen indeklinabel gebraucht, allerdings nicht attributiv (Kai ist hetero, aber *die homo Julie). Insofern scheint es schon richtig anzunehmen, dass die Normabweichung gezielt gebraucht wird, um Diversität zu visualisieren. Die abweichende Verwendung hinsichtlich der Flexion von Attributen zeigt das folgende Posting:
Das Anliegen von Ladyfest ist es, die patriarchalmännliche Dominanz in Musik und Kultur zu brechen, indem ein öffentlicher Raum für queere, transgender und feministische Kultur geschaffen wird. (https://wutimbauch.wordpress.com/2008/01/14/ladyfest-munchen-2008/)
Ein Blick in die Presse zeigt, dass die Verwendung dieser Kurzformen selten ist, aber durchaus auch in traditionellen Medien belegt ist:[2]
Viele trans* Personen stehen bei einer Bewerbung vor der Frage, ob sie die eigene Geschlechtsidentität im Vorstellungsgespräch thematisieren sollen. (Die Welt, 10.05.2019)
Unter »Sodomie« fällt auch, trans zu sein. Die größte Hürde für Transpersonen in Afrika sei überdies der schlechte Zugang zu medizinischer Versorgung. (Der Standard, 23.11.2011)
Anders als im Standard titelte die dpa am 23. April 2025 »Wie transJugendliche richtig behandelt werden sollten«. Orthografisch korrekt ist hierbei nur Transpersonen, da es sich um ein Substantiv handelt (die letzte Komponente bestimmt die Wortart, hier Person), das großgeschrieben werden muss, nicht normkonform ist trans-Jugendliche (der Bindestrich ist irrelevant). Ursache für die Kleinschreibung dürfte ähnlich der Großschreibung bei Schwarze Menschen die besondere Hervorhebung bzw. Bedeutung sein.
1 Dies sind Beispiele für mögliche Vollformen; der Bundesverband Trans* e. V. führt neben transgeschlechtlich unter anderem noch die Bezeichnungen transgender, transident, transsexuell, genderqueer, trans*, trans und nicht-binär an.
2 Alle Belege sind dem Digitalen Wörterbuch der deutscben Spracbe entnommen (https://www.dwds.de/).
Torsten Siever