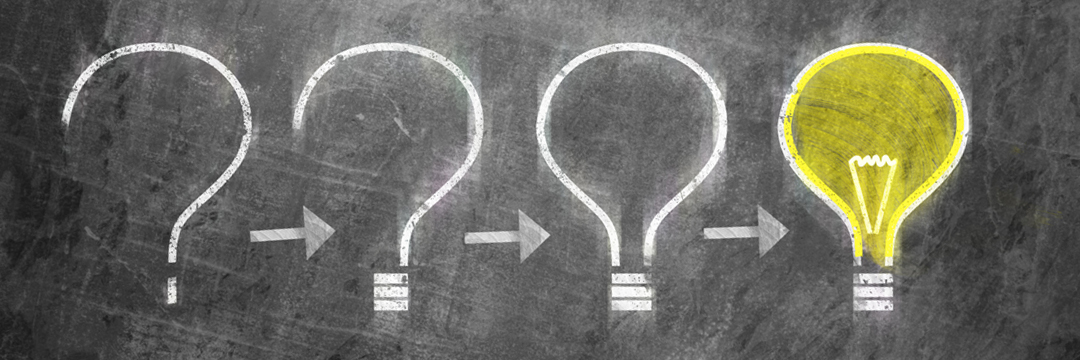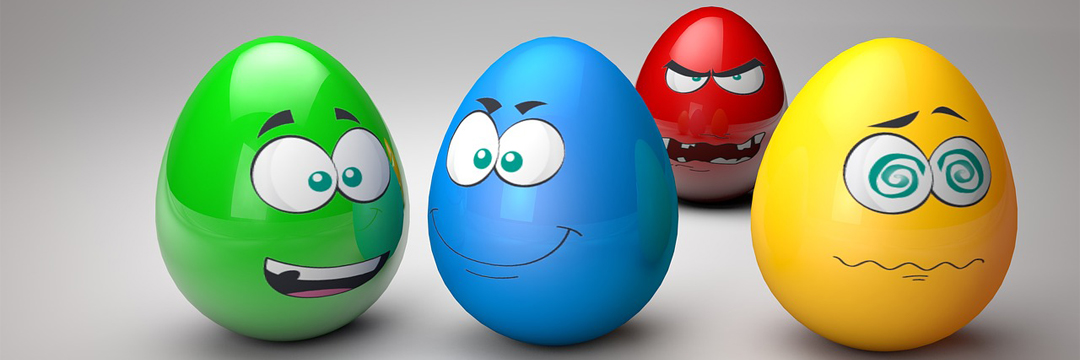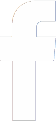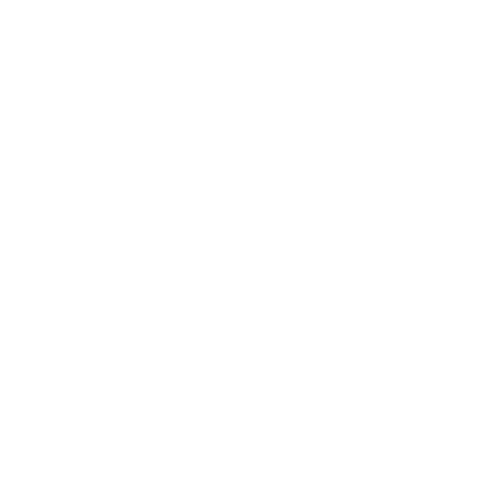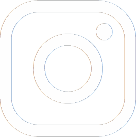wonach – seit wann gibt es dieses Wort?
[F] Ich mache mir Gedanken über das hochdeutsche Wort wonach. Seit wann ist es im Deutschen zu finden und ab wann lässt es sich durch nach was ersetzen? Stimmt es zudem, dass es im Plattdeutschen wona heißt? In einem Online-Wörterbuch fand ich nur waarna.
[A] Das Wort wonach lässt sich bereits im 13. Jahrhundert in der mittelhochdeutschen Form warnâch nachweisen.
[weiterlesen]