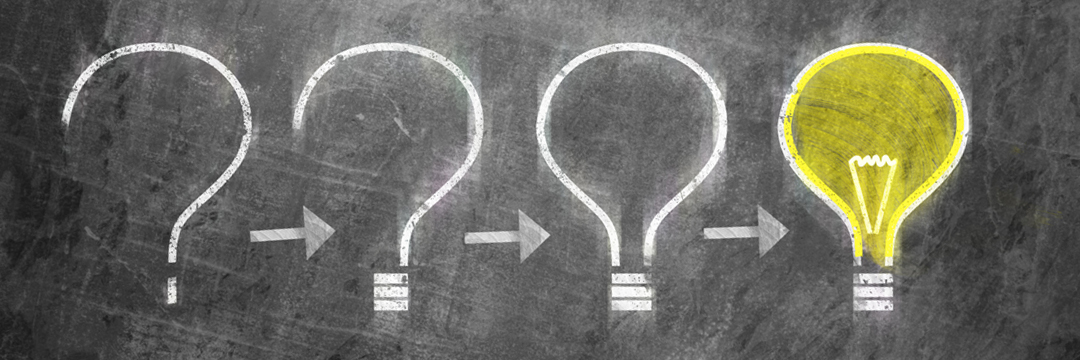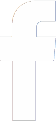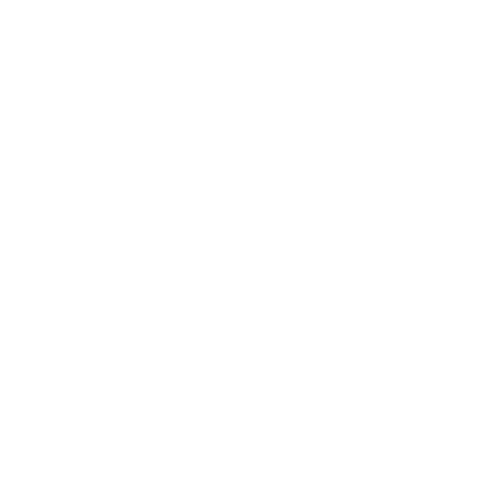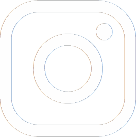Schreibt man testlesen oder Test lesen?
[F] Wie würden Sie denn schreiben: ein Buch »testlesen« oder »Test lesen«? Die Wörterbücher bringen diesen Ausdruck nicht, wohl aber Probe fahren. Ich meine, hier wäre die Zusammenschreibung am besten, und die Getrenntschreibung erscheint mir ganz unangebracht.
[A] Ich teile Ihre Ansicht. Es trifft zwar zu, dass die amtliche Wörterliste Probe fahren so wie auch Korrektur lesen getrennt aufführt, doch dabei wird auf § 55 (4) verwiesen.
[weiterlesen]