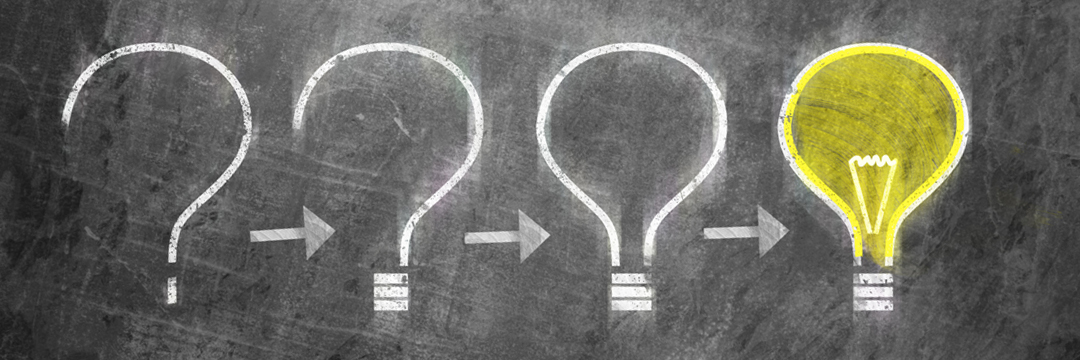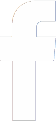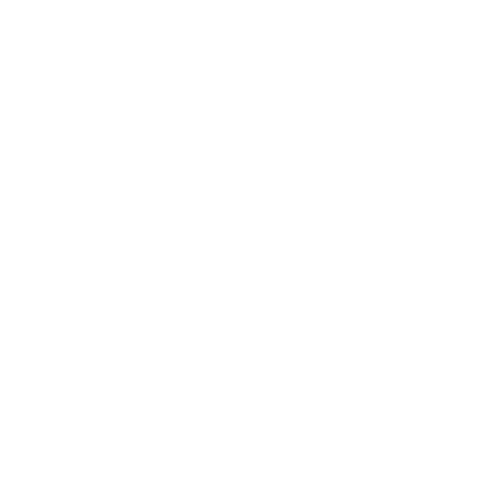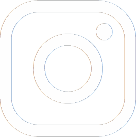Woher stammen die Namen von Ruhr und Rur/Roer?
[F] Haben die Namen der Flüsse Ruhr und Rur bzw. Roer einen gemeinsamen Ursprung? Ist womöglich die Krankheit Ruhr namensgebend?
[A] Sowohl der Flussname Ruhr als auch der Name Rur (niederländisch Roer mit der Aussprache [ru:r]) gehen zurück auf die althochdeutschen Namen dieser Flüsse: Rura. Damit handelt es sich um zwei Namen, die in der Sprachgeschichte denselben Ursprung besitzen, sich in ihrer Form jedoch unterschiedlich entwickelt haben.
[weiterlesen]