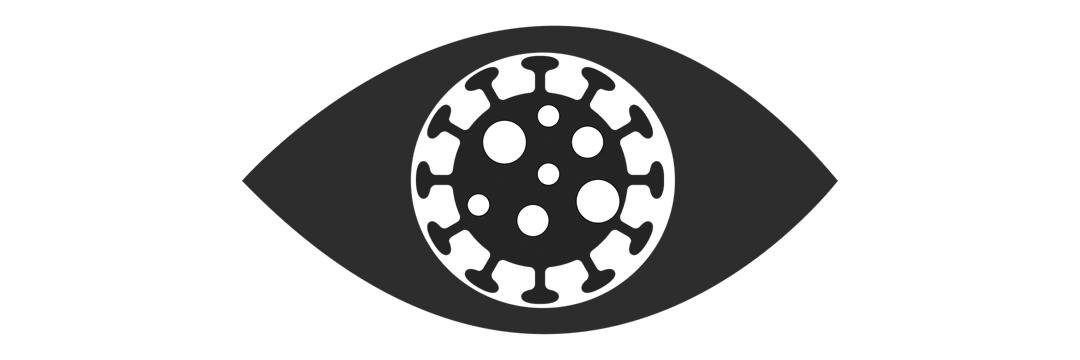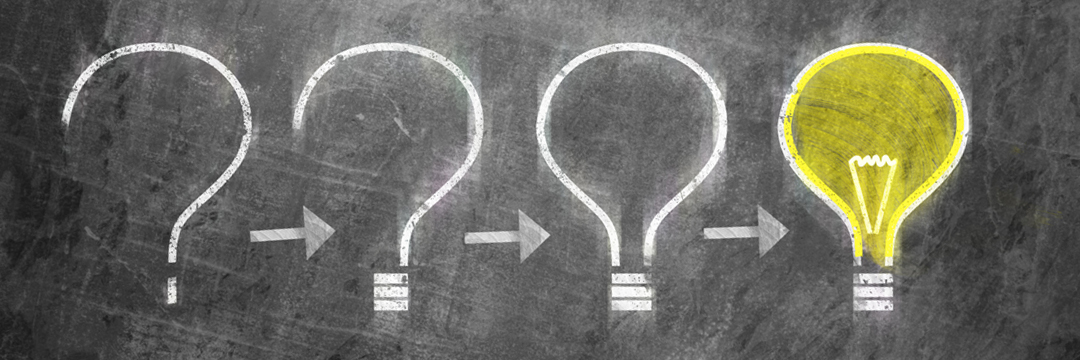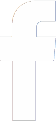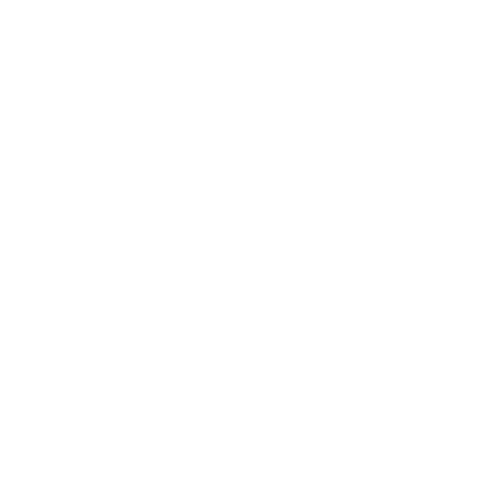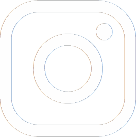Sich (k)einen Zacken aus der Krone brechen
[F] Woher stammt die Redewendung »sich (k)einen Zacken aus der Krone brechen«? Das hängt doch vermutlich nicht mit einer bevorstehenden Zahnarztsitzung zusammen – oder?
[A] Nein, die Redewendung hat nichts mit beschädigten Zahnkronen zu tun. Dennoch stammt sie auch nicht – selbst wenn dies naheläge – aus der Zeit des (hiesigen) Krone-tragenden Adels. Wenn sich jemand »einen Zacken aus der Krone bricht«, bedeutet dies, dass eine Handlung für denjenigen unter seiner Würde ist.
[weiterlesen]